No: 111
110<|>112
WASSER
TITELBLATT / Anna Sommer
OCTOPUSO`S GARDEN /
M.S. Bastian & Isabelle L.
OHNE TITEL / Anna Sommer
SCHIFFE / Mazen Kerbaj
DIE FEUCHTGEBIETEN / Philip Schaufelberger
STRAPA FUCKIN´ZINE / Marie-Hélène Talaya
OH DIO! / Lika Nüssli
BEST USE OF EVERTHING / Storyof
VENUS RISING / Aidan Koch
LULLABY / Wangxx

EDITORIAL
WASSER
Bei Anna Sommer möchte der Protagonist – wir kennen ihn bereits vom Titelblatt dieser STRAPAZIN-Ausgabe – erst nichts lieber als Wasser zum Trinken, doch als er es endlich bekommt, will er sich unbedingt am Wein laben, der arme Tropf! Tropfnass geniesst Talayas junge Frau das Leben; wie sie sich angewöhnte, nie mehr ohne saftigen Orgasmus aus dem Haus zu gehen, verrät sie uns auf drei äusserst feuchten Seiten.
In Storyofs düsterer Geschichte fliesst Wasser durch endlose Treppenhäuser und einsame Innenhöfe, es steht in Becken und Kanälen, es langweilt sich zu Tode in der schönen neuen Welt, in der es nur noch geduldet, aber nicht geschätzt wird. Noch schlimmer ergeht es dem Wasser nur noch bei Mazen Kerbaj, dessen Schiffe das Wasser geradezu hassen; sogar Amöben würden sie als Untergrund dieser mysteriösen Flüssigkeit vorziehen, von der sie nicht wissen, welche Monster sie beherbergt. Unerschütterliches Vertrauen ins Meer herrscht hingegen in den Tableaux von M.S. Bastian und Isabelle L., deren Schiffchen, Haie und Kalmare sich in einem unzerstörbaren maritimen Kosmos vergnügen, voller Optimismus, auch im Jenseits eine heile Welt aus Wind und Wellen anzutreffen. Was die pessimistisch gestimmte Dame im Comic von Wangxx ausser einem qualvollen Tod im Wasser findet, bleibt ihr Geheimnis, genauso wie wir nie erfahren werden, ob Aidan Kochs subtile Interpretation von Botticellis Venus tatsächlich einer Pilgermuschel entspross.Nun, so langweilig wie befürchtet ist Wasser beileibe nicht. Trotzdem freue ich mich schon jetzt über die STRAPAZIN-Ausgabe zum Thema «gebrannte Wässer» …
Christoph Schuler
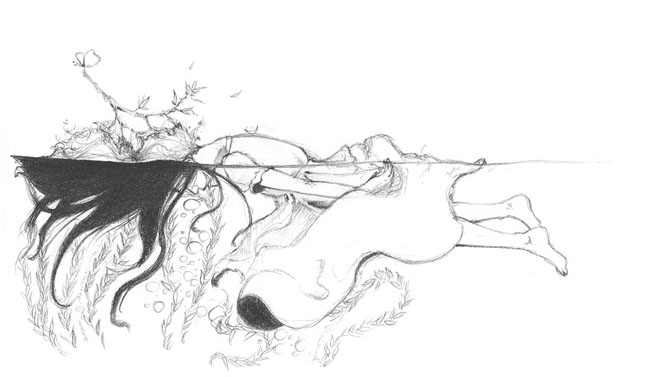
WASSERLEICHEN
Vermutlich kam meine Abneigung gegen Wasser von meiner Mutter, die Badeanstalten und Badeanzüge hasste, seit sich an ihren elegant geschwungenen Beinen feine blaue Äderchen zu zeigen begannen. Meinem Vater, der sie nicht zuletzt wegen ihrer Beine geheiratet hatte, schien nichts aufzufallen. Er kam sowieso nur selten mit uns zum See, er ging lieber bergsteigen; das tat er so lange, bis er auf einer Gletschertour beinahe in einer Spalte sein Leben aushauchte.
Ich mochte Wasser nicht, doch ich erkannte, dass ich ihm nicht für immer würde ausweichen können. In der zweiten oder dritten Klasse gab ich dem Drängen meiner Schulkameraden und meiner Mutter nach und begleitete – an den zwei, drei wirklich heissen Sommertagen – meine Geschwister in die Badeanstalt, doch ging ich nur mit Taucherbrille und Flossen ins Wasser. Ich schwamm prinzipiell nicht, ich tauchte nur. Einerseits in Ermangelung einer tauglichen Schwimmtechnik, andererseits, weil mir bei meinen Schwimmversuchen ununterbrochen Wasser ins Gesicht spritzte, was den unangenehmen Eindruck von Nässe auf ekelhafte Weise verstärkte. Meine Kameraden planschten an der Wasseroberfläche, ich lag mit schmerzenden Lungen auf dem Grund des Beckens und versuchte, so lange wie möglich unten zu bleiben. Abgesehen von verlorenen Heftpflastern und Haarspangen gab es zwar nicht viel zu sehen, aber mir gefiel das grüne Licht dort unten, der Anblick der zappelnden Glieder der anderen Kinder, die Reflexionen der Sonne, die auf dem Boden des Beckens tanzten, und vor allem die Ruhe, die dort unten zumindest so lange herrschte, bis mich plötzlich ein alarmierter Bademeister aus dem Wasser zerrte.
In der vierten Klasse mussten wir uns einmal pro Woche zum Schwimmunterricht in einer anderen Badeanstalt einfinden, einem uralten hölzernen Gebäude im Fluss. «Ab fünfzehn Grad Wassertemperatur gibt’s kein Pardon!», war Schwimmlehrer Wattmeiers Motto. Er war Deutscher, grossgewachsen, ohne ein einziges Haar auf seinem polierten Schädel, und es hiess, die drei fehlenden Finger an seiner linken Hand habe er in den letzten Tagen der Schlacht um Berlin verloren, als er bei der Flucht durch die Kanalisation einen Schachtdeckel just in dem Moment aufzudrücken versucht hatte, als ein russischer Panzer darüberfuhr. In unseren ausgeleierten wollenen Badehosen schlotterten wir im Wind und hofften vergebens auf etwas Sonne. Uns graute davor, ins Wasser steigen zu müssen, nicht nur wegen der Kälte, sondern auch wegen der Fische, die im giftigen Flusswasser der Sechzigerjahre herumzappelten. Es gab damals kaum eine Schwale, Brachsme oder Forelle ohne den grau-weissen, mit blutigen Punkten versehenen Schimmelbefall an Bauch und Rücken. Die Vorstellung, im Wasser von einem dieser todgeweihten Fische mit seinem pelzigen Tumor gestreift zu werden, liess meine Gänsehaut zu erbsengrossen Pickeln anschwellen.
«Schau mal, jetzt gibt’s hier bereits Quallen!», raunte mir Theres zu und deutete auf ein halbdurchsichtiges Ding, das sich langsam durch die Gitterstäbe des abgetrennten Aussenbeckens schob. Das war nie im Leben eine Qualle, das sah eher aus wie ein … «Ein Pariser, Scheisse!», rief Theres überrascht und auch etwas stolz, das Ding erkannt zu haben. Schwimmlehrer Wattmeier kam herbeigeeilt, gab Theres erst eine Ohrfeige, dass sie ins Wasser fiel, und machte sich dann daran, das sich träge im Wasser drehende Kondom mit dem Rettungshaken zu erwischen. Ein schwieriges Unterfangen, da das Ende des Gummis zugeknöpft war und die Luft, die sich an der abgerundeten Spitze befand, nicht entweichen konnte, was dem mit einer trüben Flüssigkeit gefüllten Ding gerade so viel Auftrieb gab, dass es knapp unter der Wasseroberfläche trieb. Zu Theres gewandt rief er: «Es gibt Ausdrücke, die ein Mädchen in deinem Alter nicht kennen sollte!»
Exakt in diesem Augenblick stach ein Sonnenstrahl durch die Wolken und fiel direkt auf Theres’ dunkelblondes Haar. Ich glaube, ich habe mich im selben Moment unsterblich in sie verliebt. Vielleicht aber auch erst, als sie, eifrig im Wasser paddelnd und dem Pariser ausweichend, Lehrer Wattmeier entgegenschleuderte: «Mädchen in meinem Alter sollten aber auch nicht ins eiskalte Wasser geworfen werden!»
Für ihre Schlagfertigkeit – eine Eigenschaft, die mir leider abging – liebte und bewunderte ich Theres unendlich. Ebenso für ihren Mut, dem rotgesichtigen Wattmeier, den wir im Verdacht hatten, mit seinen sieben übriggebliebenen Wehrmachts-Fingern die Tafel mit der Temperaturanzeige vor der Schwimmstunde nach Gutdünken zu manipulieren, freche Antworten zu geben, was ich mich nie getraut hätte. Vielleicht rührte ihre Fähigkeit, sich zu wehren, daher, dass sie aus einer armen Familie kam und, wie sie freimütig erzählte, mit ihren drei Brüdern im selben Bett schlafen musste, weil kein Geld für weitere Matratzen da war. Ihr Haar hielt sie mit roten Gummiringen zusammen, die man üblicherweise als Dichtungen für Einmachgläser benützt, ihre Kleider waren schon unzählige Male mit farblich unpassendem Garn geflickt worden, und sie musste die Schuhe ihrer Brüder austragen, löchrige Dinger mit Holzsohlen, wie ich sie nur von Illustrationen in Märchenbüchern kannte.
Trotz ihrer Herkunft war Theres’ Auftreten ebenso anmutig wie elegant, ihre derbe Sprache verlieh ihrer Erscheinung sogar zusätzlichen Reiz, fand ich. Und sie konnte schwimmen wie eine Forelle! Was kein Wunder war, wohnte sie doch unmittelbar am Fluss in einer ehemaligen Mühle, die schon zur Zeit der Reformationskriege wegen Baufälligkeit hätte abgebrochen werden sollen, und deren Garten ohne Zaun ins Flussufer überging. Dort aufwachsende Kinder fielen alle paar Tage in den träge dahinziehenden Fluss – wer nicht schnell schwimmen lernte, lebte nicht lange.
Ein einziges Mal nahm Theres mich mit zu ihr nach Hause. Über eine knarrende Holztreppe gelangte man in die Wohnung, deren aus Stoffresten gewobene speckige Teppiche übersät waren mit zerfetzten Zeitungen, bis zum Filter abgerauchten Zigarettenstummeln, leergelutschten Kondensmilch-Tuben und geknickten Kronenkorken. Am Fenster, mit dem Rücken zu uns, stand ein stark behaarter Mann in Unterhemd und Trainerhosen, zu jung, um Theres’ Vater, zu alt, um einer ihrer Brüder zu sein; mit der linken Hand ein Fernglas vor Augen haltend, schien er mit der rechten einen in der Hosentasche versteckten Apparat zu betätigen, der dazu diente – so überlegte ich mir – die Menschen zu zählen, die er auf der Liegewiese der Badeanstalt auf der anderen Seite des Flusses beobachtete. Er drehte sich nicht um, auch dann nicht, als Theres’ Mutter ins Zimmer trat, eine Zigarette zwischen den Lippen, eine weitere durch ein grosses Loch im Ohrläppchen gesteckt, und ihn anblaffte: «Wehe, du versaust die Gardinen!» Zu mir gewandt meinte sie: «Glaub bloss nicht, dass du hier was zu essen kriegst!»
…
Christoph Schuler

DAS GESCHRIEBENE WORT
WASSER IST ZUM WASCHEN DA...
Wasser ist zum Waschen da, falleri und fallera.
Auch zum Zähneputzen kann man es benutzen!
Es gibt ja auch noch tausend andere Flüssigkeiten, die man zu sich nehmen kann. Auch solche, die einen ganz merkwürdig fröhlich und dann krank machen, wenn man sich der Zufuhr über längere Zeit aussetzt. Aber davon später einmal. Wieder andere weisen auf die Wirklichkeit und das reale Vorkommen hin: Wasser? Das geht uns aus! Das wird einmal so wertvoll und teuer sein wie das Erdöl heute! Wasser wird von den multinationalen Konzernen ausgebeutet, künstlich verknappt. Ausserdem sorgt der menschliche Raubbau für das Versiegen der natürlichen Süsswasserquellen, der Flüsse. Über das unlautere Riesengeschäft mit dem Wasser in Flaschen, dem sich zum Beispiel der Konzern Nestlé seit geraumer Zeit widmet, gibt es einen sehens- und bedenkenswerten Film mit dem Titel «Bottled Life», eine schweizerisch-deutsche Produktion von Urs Schnell aus dem Jahr 2012.
In der Literatur kann man Wasser wie folgt klassifizieren:
Das Meer als literarische Fläche
An welche Geschichte, an welche Figuren denkt man bei diesem Thema zuerst? An den verdammten weissen Wal und seinen noch viel verdammteren einbeinigen Jäger, also an Moby Dick und Kapitän Ahab. «Nun flogen kleine Vögel kreischend über dem noch gähnenden Abgrund; mürrische weisse Wellen schlugen gegen seine steilen Wände; dann brach alles ein, und das grosse Leichentuch des Meeres wogte weiter wie vor fünf Jahrtausenden.»
Herman Melvilles höchst voluminöser Roman ist in jeder Beziehung ein Monster. Von den biblisch anmutenden Geschehnissen berichtet ein gewisser Ismael, der auktoriale Erzähler, der selbstverständlich als einziger die Katastrophe überleben muss. Melville (1819 –1891) war selbst Walfänger in Nantucket, dem wichtigsten Walfängerhafen der USA, und deshalb wimmelt es in seinem Roman auch nur so von wissenschaftlichen und volkskundlichen Beschreibungen und Klassifikationen der Meerestiere sowie der blutigen Arbeit und der Bräuche der Walfänger. Das alles findet neben der epischen Jagd auf den weissen Wal seinen Platz in diesem Romanungetüm. Moby Dick sollte man gelesen haben, aber selbstverständlich nicht so eine gesäuberte Jugendbuchfassung, sondern die am Schluss des Textes erwähnte Ausgabe.
Das gilt übrigens auch für Edgar Allan Poes «Der Bericht des Arthur Gordon Pym». Im einzigen Roman des Grossmeisters des Schaurigen, der 1838 erschien, ist der Held schon als Jugendlicher dem Meer, den Schiffen, der Abenteuerlust und Selbstherausforderung verfallen. Schliesslich durchleidet er Schiffbruch, Hunger, Durst, Wahnsinn und auf dem Seeweg zur geheimnisvollen, unerforschten Antarktis diverse übernatürliche Phänomene, doch er hat ja immer wieder selbst diese Extremsportarten des 19. Jahrhunderts ausgeübt. Arthur Gordon Pym kann wohl Edgar Allan Poe bedeuten und dürfte eine allegorische Biographie sein.
Rationaler und gegenwärtiger, aber nicht minder tragisch geht es im neuen Buch des Basler Schriftstellers und Radiojournalisten Christoph Keller zu und her. Seine Handlungsfläche in «Übers Meer» ist das Mittelmeer und all das, was es heute bedeutet: die Grenze zur Festung Europas, die Klammer eines uralten Kulturraums, der heute aber auf vielerlei Arten ökonomisch, religiös und politisch zersplittert ist. Handelnde sind das einstige Paar Astèr und Claude, die in den 1980er-Jahren Häuser besetzt haben und die Gesellschaft umstürzen wollten. 20 Jahre später verabreden sie sich auf der Insel Djerba, knapp vor dem tunesischen Festland. Doch Claude gerät mit seinem Boot in einen Sturm und wird schiffbrüchig, Astèr wird Opfer eines Anschlags von islamistischen Fundamentalisten und verliert dabei ihr Kurzzeitgedächtnis.
Daneben gibt es noch andere Stimmen in diesem eindrucksvollen Roman, die erzählen: ein Flüchtling aus Nigeria, der halbtot in Italien ankommt oder ein tunesischer Taxifahrer, der gegen die Islamisten argumentiert.
Nochmal zu Moby Dick: Über den Wal, oder den Leviathan, wie er im englischen Sprachgebrauch heisst, schreibt auch der englische Journalist Philip Hoare in einem eben erschienenen Buch. «Auf der Suche nach dem mythischen Tier der Tiefe» heisst es im Untertitel. Hoare ist selbst seit jeher fasziniert von Walen und versucht, der Anziehungskraft dieses Tiers auf die Menschen (ich sage nur Walgesänge) auf die Spur zu kommen. Ist der Wal nun ein Symbol paradiesischer Unschuld in Zeiten der Artenbedrohung oder eher ein uraltes Sinnbild für das Böse schlechthin?
Der Fluss als literarisches Fliessen
Während beim Meer immer alles schrankenlos, unendlich und mehr oder weniger hoffnungslos ist, evoziert der Fluss in der Literatur eher sogar eine Geborgenheit. Der Fluss hat die Geschwindigkeit und eine Richtung, in der beispielsweise eine Flucht gelingen kann. Die Ufer sind nahe, aber auch eventuelle Verfolger. Das Wasser des Flusses ist eindeutig weniger gefährlich als das des Meeres, auch die Dinger, die darin herumschwimmen, erscheinen bedeutend weniger unheimlich.
Der grosse Flussroman ist schon wieder von einem Amerikaner, von Mark Twain, der den Mississippi besingt, wo seine beiden berühmten Abenteuer- und Entwicklungsromane über Tom Sawyer und Huckleberry Finn spielen.
Der 1951 geborene Joe R. Lansdale hat in seinem Abenteuerroman «Dunkle Gewässer» dagegen den Sabine River in Texas als Schauplatz gewählt. Die Hauptpersonen dieses sehr spannenden und recht gewalttätigen Hinterwäldlerdramas sind drei Teenager, die Geld aus einem Banküberfall gefunden haben und damit vor brutalen Stiefvätern, geldgierigen Verwandten und korrupten Sheriffs abhauen, den schlangenverseuchten Sabine River hinunter. Allerdings ist auch noch ein verrückter Killer auf ihrer Spur, was zu einem wahrlich biblischen Showdown führt. Lansdale ist einigermassen bekannt für höchst originelle Horror- und Fantasy-Stories und als Krimiautor ein Geheimtipp.
Der Fluss als Wirklichkeit oder als Lebensgrundlage
Warum fliesst er denn nicht mehr, der Fluss? Vielleicht, weil sein Lauf ein paar hundert Kilometer weiter oben gestaut oder so reguliert worden ist, dass er nur noch bei grösseren Regenfällen als Überschwemmung existiert. Da sind auch unterirdische Flüsse, Süsswasserquellen, die sinn- und planlos ausgebeutet wurden. Beispiele für solchen Raubbau und derartige Dummheit gibt es viele und der Wissenschaftsjournalist Fred Pearce führt sie in einem ziemlich umfassenden und eindrücklichen Buch auf. Er erzählt sozusagen Flussgeschichten, die alle irgendwie tragisch ausgehen, weil der Mensch in seiner Verblendung in natürliche Abläufe eingegriffen hat. Sei es am Mekong, am Nil oder am Aral-See, dessen Zuflüsse man abgeleitet hatte, um in der Wüste Baumwollfelder anzulegen. Oder die Madan-Sümpfe zwischen Euphrat und Tigris, die Saddam Hussein trockenlegen wollte und die heute für viel Geld renaturiert werden.
Das Wasser als mythologisches Instrument
Iudicium Acquae frigidae, die Wasserprobe, auch das Hexenbad genannt, ist eine Art des Gottesurteils und gehört zu den uralten Volksrechten. Es geht auf den vorchristlichen Glauben von der Reinheit der Elemente zurück. Wasser kann also keinen Verbrecher in sich aufnehmen. Der auf dem Wasser Schwimmende, an Händen und Füssen gefesselt, ist schuldig. Wer versinkt, hat dadurch seine Unschuld bewiesen, meist aber auch sein Leben verloren. Eine elegante juristische Lösung, die einem von der Struktur her auch heute noch sehr bekannt vorkommt.
Die Hexenprozesse vom 16. bis 18. Jahrhundert brachten die Wasserprobe noch einmal aufs Tapet. Der englische König Jakob I., der die Bibel erstmals ins Englische übersetzen liess und Autor einer vielbeachteten «Demonology» aus dem Jahre 1597 war, kam zu der originellen Erkenntnis, «dass das Wasser jene in seinen Schoss aufzunehmen widerstrebt, die das Heilige Wasser der Taufe von sich abgeschüttelt haben».
Nachsatz: Nantucket Sleighride heisst das zweite Album der amerikanischen Hardrockband Mountain aus dem Jahre 1971. Das dritte Stück ist eine sechsminütige Metallballade mit dem Titel «Nantucket Sleighride (to Owen Coffin)», übrigens mit einem sehr inspirierten Solo des übergewichtigen Gitarristen Leslie West. Sleighride bedeutet, dass das Schiff vom harpunierten Wal übers Meer gezogen wird, bis dessen Kräfte erlahmt sind. Owen Coffin seinerseits war Schiffsjunge auf dem Walfänger «Essex», der 1820 von einem Pottwal gerammt und versenkt wurde. Coffin war unter den letzten Überlebenden und das Los wählte ihn als Nahrung aus für die übrigen Schiffbrüchigen. Die Geschichte der Essex ist die reale Grundlage von Melvilles «Moby Dick».
Bücher:
- Herman Melville: «Moby Dick»
- Übersetzt von Matthias Jendis
- btb, 1041 Seiten, sFr. 18.90
- Christoph Keller: «Übers Meer»
- Rotpunktverlag, 296 Seiten, sFr. 30.–
- Philip Hoare: «Leviathan»
- Mare Verlag, 528 Seiten, sFr. 36.50
- Joe R. Lansdale: «Dunkle Gewässer»
- Tropen Verlag, 320 Seiten, sFr. 27.90
- Fred Pearce: «Wenn die Flüsse versiegen»
- Kunstmann Verlag, 398 Seiten, sFr. 34.60

DAS MAGAZIN
Lukas Jüliger: «Vakuum»

Nicht Erwachsen werden
Erste Liebe, Pubertät, Unsicherheiten: Lukas Jüligers Debüt «Vakuum» beginnt wie ein typischer Coming-of-Age-Comic. Der namenlose, schüchterne Protagonist lernt in der Schule ein Mädchen kennen – «Ihr Name klang nach Sommer.» Die beiden nähern sich einander vorsichtig und erleben ihre erste Liebe. Doch irgendetwas an Jüligers Album ist anders als in Comics mit ähnlicher Thematik. Was genau jedoch so anders und verstörend ist, bleibt zunächst kaum greifbar: Sind es die düsteren Farben, die alles in eine melancholische Grundstimmung tauchen? Oder die zunehmend seltsamen und verstörenden Begebenheiten, die sich in die Handlung einschleichen, bis sie schliesslich die Geschichte zu übernehmen scheinen? Ben Fimming, der eine Matratze in den Wald trägt (auf der er sich später umbringen wird), ein heimlicher Besuch im Leichenschauhaus, die nächtlichen Spaziergänge des Sommer-Mädchens oder die zunehmende Schweigsamkeit von Sho, dem besten Freund des Protagonisten … Im verstörenden Nebenstrang um Sho wird erzählt, wie dieser nach einem Drogentrip nicht mehr der Gleiche ist, sich als Folge dieser Erfahrung über den Comic hinweg scheinbar aufzulösen versucht, schweigend und apathisch all seinen Besitz in der Welt verteilt, bis sein Zimmer schliesslich komplett leer ist. Eines der vielen Bilder Jüligers für den Prozess, in dem sich die Protagonisten befinden, die Jugend, in der auf das neue Leben als Erwachsener vorbereitet werden soll, von dem aber fraglich bleibt, ob die Protagonisten dieses neue Leben in Jüligers apokalyptischer Coming-of-Age-Version überhaupt erleben werden.
Immer tiefer wird der Leser in den Strudel – oder das Vakuum – Jugend hineingezogen, in die Unbehaglichkeiten und Verstörungen – bereits auf dem Cover sind die Protagonisten von Scherben, Müll, Schutt und Messern umgeben. Eine Gegenstrategie scheint die Kunst zu sein: Das Mädchen malt After, nach dem Vorbild einer in einer einsamen Hütte im Wald befindlichen mysteriösen Öffnung im Boden. Steckt man den Finger hinein, so bewirkt dies den berauschenden Sog eines Drogentrips – doch auch diese Bewältigungsstrategie wird zerstört. Nichts in der Welt von «Vakuum» ist am Ende noch wie am Anfang. Anders jedoch als im klassischen Coming-of-Age-Geschehen, wo die Protagonisten nach den Wirren der Jugend als gefestigte Erwachsene durchs Leben gehen, bleibt diese Möglichkeit den Personen bei Jüliger verwehrt: Das Drama endet nicht mit dem Erwachsenwerden, vermutlich – doch auch dies bleibt offen – fängt das wahre Drama damit erst wirklich an. Als das wahre Glück erscheint der Schwebezustand zwischen Verstörung und Zerstörung, Melancholie und Glück, und der gemeinsame Untergang: «Wie fragt man das jemanden? – Hättest du Lust, mit mir zu sterben?».
Jonas Engelmann
- Lukas Jüliger: «Vakuum»
- Reprodukt, 112 S., Softcover, farbig,
- Euro 20 / sFr. 28.90
Helmut Wietz: «Der Tod von Adorno»
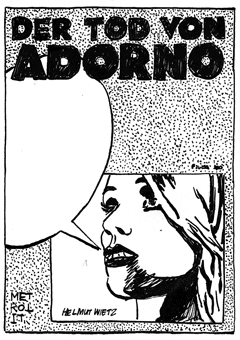
Adorno-Porno
«Der Comic sollte am Anfang ‹Candide oder ein Sieg der Freiheit› heissen, aber die Auseinandersetzung der Studenten mit ihren intellektuellen Vorbildern wie Adorno färbte dann doch ganz stark auf die Geschichte ab», schreibt Helmut Wietz im Nachwort zu seinem bereits 1967 begonnenen und erst jetzt vollendeten Comic «Der Tod von Adorno». Die Geschichte des von Wietz in die Gegenwart der Sechziger überführten Candide – hier unter dem Namen Trollschack, einem naiven Proletarier vom Lande – ist durchdrungen von den damals dominierenden Themen: Politik, APO, RAF, Kritische Theorie und freie Sexualität. Innerhalb dieser Koordinaten bewegt sich der Protagonist Trollschack zwischen protestierenden Studenten und sucht nach dem «richtigen Ausgang im Falschen». Ist es der «systemverändernde Pornofilm» oder die Lehre der «Gralshüter der dialektischen Aufklärung» im «Elfenbeinturm» der Frankfurter Universität?
Bei einem Besuch in Frankfurt wird Adorno aufgrund seiner Verbissenheit, seiner vermeintlichen Humorlosigkeit und seines fehlenden Vertrauens in die 68-er von Trollschack kritisiert, doch auch der anderen Seite, den Revolutionären, traut er nicht über den Weg. Der wahre und gemeinsame Feind jedoch sind die alten Nazis, die sich an allen wichtigen Schaltstellen in der BRD eingenistet haben, und denen weder Adorno noch die Studenten Herr werden. Erst Trollschack entwickelt einen utopischen Plan, der schliesslich ausgeführt wird. Wie einst die mittelalterlichen Ausgestossenen auf das Narrenschiff werden die Altnazis auf einen Dampfer verfrachtet: «Was sie nicht wissen, ist, dass sie dazu verdammt sind, bis ans Ende ihrer Tage nie wieder in einem Hafen einlaufen zu können.» «So ist nun», meint Trollschack bevor er nach erledigter Arbeit wieder in seine norddeutsche Provinzheimat zurückkehrt, «die verlogene Koexistenz von Tätern und Opfern auf harmonische Weise beendet.»
Auf jeder Seite ist das Unbehagen aufgrund der politischen Karrieren ehemaliger Nazis und der gesellschaftlichen Prüderie zu spüren, das Wietz’ Generation begleitet und die 68-er eingeleitet hat. Dieser Realität gegenübergestellt ist die Hoffnung auf eine neue Politik und Kunst, wie etwa den Comic, der sich im Falle von Wietz ästhetisch irgendwo zwischen Pop-Art und amerikanischen Vorbildern wie Joe Brainard bewegt. Doch daneben sind ebenso auf jeder Seite die unangenehmen Aspekte der 68-er zu spüren, beispielsweise die hinter dem Ruf nach sexueller Befreiung versteckten Macho-Attitüten, wenn Trollschak «Apomuschi Monika», die er im Flugzeug nach Berlin kennenlernt, konsequent «die feuchte Monika» nennt. Dadurch steht der Comic sich immer wieder selbst im Wege und untergräbt die berechtigte Gesellschaftskritik von Wietz’ Generation: Es sind noch immer die gleichen Altherrenwitze der Väter, nun bloss in bunte Bilder verpackt. Adorno jedenfalls hätte sich im Grabe umgedreht.
Jonas Engelmann
- Helmut Wietz: «Der Tod von Adorno»
- Metrolit, 72 S., Hardcover, farbig
- Euro 22 / sFr. 31.40
G.Beltrán, B.Seguí: «Geschichten aus dem Viertel»
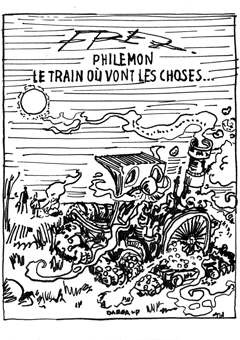
Erinnerungen an eine Jugend im Elend
Eigentlich sind die «Geschichten aus dem Viertel» der beiden Mallorquiner Gabi Beltrán und Bartolomé Seguí alles andere als schön. Charme haben sie trotzdem und auch etwas Versöhnliches. Eigentlich geht es um Jugendliche, die ohne Hoffnung auf ein gutes Leben aufwachsen, die sich den Tag mit Diebstählen, Spritztouren und Drogen vertreiben, und von denen fast keiner seinen 30. Geburtstag erlebt. Schauplatz ist das «Barrio Chino», das Rotlicht-Viertel von Palma de Mallorca, im Jahr 1980. Hauptdarsteller ist Gabi Beltrán selbst. In acht Comic-Episoden und sechs Prosa-Passagen rollt Beltrán auf, wie er sich – im Unterschied zu seinen Freunden – von jener kleinen, traurigen und schmutzigen Welt löst, und die Laufbahn einschlägt, die ihn zu einem profilierten Comic-Autor macht (unter anderem publizierte er in STRAPAZIN #74 vom März 2004).
Der Weg zu dieser Trennung beginnt für Gabi aufregend: Es ist der Sommer 1980, «als wir anfingen, schneller als die meisten Jungen in unserem Alter zu leben», erinnert sich Beltrán. Was für den 14-Jährigen vergleichsweise harmlos anfängt mit der Vermittlung zwischen Matrosen und Prostituierten, dem Knacken von Spielautomaten oder einem Bordellbesuch, steigert sich zu Ladenüberfällen und Autodiebstählen. Als eine Polizeistreife einen Einbruchversuch vereitelt, erleidet Gabi einen Streifschuss. Von nun an reagiert er zunehmend mit Unruhe, Wut und Unverständnis auf seine Umwelt. Als seine Freunde dem Heroin erliegen und die Gewalt zuhause nicht abnimmt, bricht er den Kontakt ab.
Beltrán schildert die Ablösung subtil: Er hält sich mit moralischen Urteilen zurück, achtet auch jene, deren Leben unglücklich verläuft, und beschönigt trotzdem nichts. Unverstellt beschreibt er, wie radikal er sich von Freunden und Familie trennte, und lässt den Leser dennoch spüren, dass er mit seiner Vergangenheit Frieden geschlossen hat.
Bartolomé Seguís Zeichnungen unterstützen diesen Eindruck: Die klassisch-«belgisch» anmutenden Figuren, die schönen Landschaften und die dezenten Farben wirken zunächst eher zu niedlich für so harte Themen wie Drogensucht und Jugendkriminalität – doch genau dadurch verdeutlichen sie die Kernaussage: Auch ein unschönes Leben ist ein normales und lebbares Leben.
Florian Meyer
- Gabi Beltrán, Bartolomé Seguí: «Geschichten aus dem Viertel».
- Avant-Verlag, 152 S., farbig, Softcover,
- Euro 19.95 / sFr. 30.–
K.Ichiguchi: «Les Cerisiers fleurissent malgré tout»

Der Mut zum Leben und die Katastrophe
Fukushima im Frühjahr 2011 – zuerst die Flutwelle, dann der Reaktor. Die Bilder jener Katastrophe prägten sich weltweit in die Gedächtnisse ein – schockartig wie wohl keine mehr seit den Terroranschlägen auf die New Yorker Zwillingstürme zehn Jahre zuvor. Von den Katastrophenbildern ist im Comic «Die Kirschbäume blühen trotz allem» (frz. «Les cerisiers fleurissent malgré tout») wenig zu sehen. Die Japanerin Keiko Ichiguchi schildert das Fukushima-Drama vielmehr, indem sie dem alltagsbezogenen Stil der Josei-Manga («Comics für Frauen») folgt und Menschen im Wechselbad ihrer Gefühle vorstellt. Im Mittelpunkt der Erzählung steht Itsuko Sonoda, eine japanische Journalistin, die mit ihrem Lebenspartner Angelo, einem Comic-Autor, in Italien lebt. Itsuko teilt viele Züge mit der Autorin, die in Bologna wohnt und arbeitet, ist jedoch nicht mit ihr identisch.
Wie die Flutwelle über die Ostküste Japans so bricht die «Lawine katastrophaler Nachrichten» schlagartig über Itsuko herein und stellt ihren Alltag in wenigen Minuten auf den Kopf. Soll sie ihre Eltern in Osaka besuchen? Die Stadt liegt zwar weit weg vom Erdbebengebiet, was aber ist mit der Verstrahlung? Die Nachrichtenlage verunsichert zusätzlich. Italienische Medien stellen die Fakten zuweilen ungenau dar, die japanischen Behörden mitunter gar nicht. Ist es wirklich ein Glück, fernab in Europa zu sein, wenn das Heimatland Not leidet?
Solche Gedanken schiessen Itsuko durch den Kopf, und sie mischen sich mit Erinnerungen an ihre Kindheit. Damals setzte sie sich wegen einer schweren Krankheit intensiv mit dem Tod und dem Sterben auseinander. Vor diesem Erfahrungshorizont verarbeitet Itsuko ihre Ängste. Aufgrund der Konsequenz, mit der Keiko Ichiguchi diese Schockverarbeitung darstellt, könnte man «Les cerisiers fleurissent malgré tout» gut und gerne als «therapeutischen» Comic bezeichnen. Berührend und eindrücklich ist es, wenn zum Beispiel Itsuko beim Sarg ihres Grossonkels kniet und reflektiert, was Sterben bedeutet. «Der Tod steht den Lebenden immer zur Seite, aber neben dem Tod gibt es auch die Zärtlichkeit des Lebens», sagt sie, und dieses Zitat ist typisch für die ganze Geschichte.
Florian Meyer
- Keiko Ichiguchi: «Les Cerisiers fleurissent malgré tout».
- Ed. Kana (Dargaud/Lombard), 122 S., Softcover, s/w,
- Euro 15 / sFr. 22.50
Fred: «Philémon 16: Au train où vont les choses»
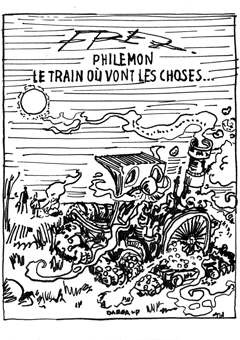
Die Macht der Imagination
In seiner Serie «Philémon» erzählte der französische Comic-Altmeister Fred fantastische Geschichten aus einer poetischen Gegenwelt. In Frankreich gehört er längst zu den ganz Grossen des Comics – hierzulande blieb er unbekannt.
Hustend stolpert Philémon, der ewige Jüngling im blauweiss gestreiften Pullover, durch den übel riechenden Nebel, der sich plötzlich über die Gegend gelegt hat. Ein Fremdling, gewandet wie ein zum Zirkusdirektor mutierter Lokomotivführer, führt ihn zur Lokoapattes (Lokomotive mit Pfoten): Sie sei krank und drohe im Sumpf zu versinken. Und schon sind wir mittendrin im neuen Abenteuer von Philémon, «Au train où vont les choses», das – wenige Wochen vor dem Tod seines Schöpfers Fred erschienen – die vor knapp fünfzig Jahren begonnene Serie auf magistrale Weise abschliesst.
Um sich wieder in Bewegung zu setzen, benötigt die Lokomotive, eine hoch sensible Kreuzung aus Lokomotive und Nilpferd, nämlich Dampf. Keinen gewöhnlichen Dampf, sondern «Imaginationsdampf»: Nur eine gute Geschichte bringt sie in Fahrt.
Wo der Poet König ist…
Imaginationsdampf hatte Fred mehr als genug. Seine Comics spielen sich in einem parallelen Universum ab, einem poetischen Utopia, in der die Geschichtenerzähler, Poeten und Fabulierer Könige sind.
Fred, eigentlich Frédéric Othon Théodor Aristides, wurde am 5. März 1931 als Sohn griechischer Einwanderer in Paris geboren. Bereits während seines Studiums arbeitete er für so namhafte Publikationen wie Paris-Match, France Dimanche, Punch und The New Yorker, geriet schon früh in den Dunstkreis des Satirikers und Provokateurs François Cavanna und gehörte 1960, zusammen mit Roland Topor, Reiser und Cabu, zu den Mitbegründern der Satirezeitschrift Hara-Kiri. 1965 bot Fred René Goscinny, dem Chef-Redaktor von Pilote, die erste Geschichte um Philémon an, die erste von insgesamt fünfzehn, die bis 1987 in Pilote vorabgedruckt wurden und nun in einer schmucken dreibändigen Gesamtausgabe vorliegen. Obschon Fred neben «Philémon» auch andere grossartige Comics veröffentlichte, war früh offensichtlich, dass dies das Haupt- und Meisterwerk des kleinen Manns mit dem buschigen Schnurrbart und dem Schalk in den Augen war.
Portal in eine andere Welt
Dank eines Ziehbrunnens pendelt Philémon mit seinem Onkel Félicien und seinem Esel Anatole zwischen seinem Dorf im tiefsten Frankreich und einer fantastischen Inselgruppe hin und her. Jede Insel hat die Form eines Buchstabens des Worts «Océan Atlantique», und sie werden nicht nur vom Schiffbrüchigen Barthélémy und seinem Gefährten, dem Zentauren Vendredi (Robinson lässt grüssen …) bewohnt, sondern auch von bizarren Lebewesen wie Papiertigern und wilden Klavieren.
Auf diesen Schriftzeichen der Fantasie ist alles möglich; Philémons Abenteuer werden angetrieben von purem Imaginationsdampf, von verblüffenden Sprachspielen, von anarchischer Poesie, von melancholischer Komik und nicht zuletzt auch von einer verspielten Reflexion der Comic-Sprache. Kaum einer hat die Syntax der Comics dermassen raffiniert dekonstruiert und den Blick des Lesenden dermassen listig manipuliert und ins Leere laufen lassen wie Fred.
Im Sumpf der Depression
1987, nachdem Fred die ersten zwanzig Seiten des sechzehnten Albums gezeichnet hatte, blieb «Philémon» jedoch stecken wie die Lokoapattes: Eine schlimme Depression führte zu Freds Einweisung in eine psychiatrische Klinik. Die Genesung brachten allerdings nicht die Ärzte, sondern ein Comic: «L‘Histoire du corbac aux baskets» (1993) ist die in schwermütigen Humor getränkte Ballade um einen Mann, der zur Krähe wird und mit Rassismus, Wahnsinn und dem Kult des Scheins konfrontiert wird.
Es dauerte aber noch knapp zwanzig Jahre, bis Fred das abgebrochene Abenteuer Philémons wieder aufgriff – und es mit einer verblüffenden Volte zum Abschluss brachte und zugleich zum Neubeginn der Serie machte: Philémon und sein Onkel Félicien schaffen es tatsächlich, die Lokoapattes aus dem Sumpf zu befreien und auf ihr neuen Abenteuern entgegenzutraben: Indem sie ihr ganz einfach den Anfang von «Le Naufragé du ‹A›» erzählen, einer der allerersten Philémon-Geschichten. So schuf Fred, kurz vor seinem Tod am 2. April 2013, einen Kreislauf, in welchem seine Imagination für immer und ewig dampfen wird, ohne sich je zu verflüchtigen: inspirierend, unterhaltend, bereichernd.
In Frankreich gilt Fred längst als einer der ganz Grossen, der viele jüngere Autoren, allen voran Joann Sfar, geprägt hat. Im deutschen Sprachraum war Fred allerdings nicht der geringste Erfolg beschieden – seine Mischung aus Fantasie, Humor, Melancholie, Anarchismus und Poesie war für die deutsche Comic-Szene lange zu eigenwillig und fremd, und ob sich heute ein Verlag traut, diesen Schatz zu heben, scheint fraglich.
Christian Gasser
- Fred: «Philémon 16: Au train où vont les choses».
- Dargaud, 40 S., Hardcover, farbig,
- Euro 13.99 / sFr. 21.–
- Fred: «Philémon: L‘Intégrale» (drei Bände).
- Dargaud, je ca. 280 Seiten, Hardcover, farbig,
- je Euro 35 / sFr. 51.70
Eric Lambé: «Le fils du roi»

Ein royaler Wachtraum
«Eines Tages flüsterte mein Vater mir ins Ohr: Wisse, Du bist des Königs Sohn.» Auf diesen Satz folgt kein weiteres Wort, sondern ein 90 Seiten langer, mit blauem und schwarzem Kugelschreiber gezeichneter Bildersog, bei dessen erster Lektüre man so überwältigt ist, dass man gar nicht erst dazu kommt, sich zu fragen, ob «Le fils du roi» eine Geschichte erzählt, und wenn ja, was für eine.
Erst beim zweiten und dritten Lesen schält sich neben der visuellen Stringenz auch so etwas wie eine narrative Logik heraus; es geht um eine Frau und einen Mann, es geht um Begegnungen, Beziehungen, Brüche, Trennungen.
«Le fils du roi» sei eine zugleich melancholische und groteske Geschichte, sagt Eric Lambé selber: «Eine Reflexion über die Zeit, das Licht, das Schöne und das Hässliche, das Akademische und das Ikonoklastische, das Monströse, die Fantasie, das Eingesperrtsein, den Wahnsinn.» Er vergleicht sein Opus auch mit einem Wachtraum. Genau das haben die Zeichnungen dem Betrachter längst zu spüren gegeben: Es sind akkurat gekritzelte Netze aus Kugelschreiberstrichen, die Mutationen und Metamorphosen durchmachen, die Linien zittern und beben, sie rutschen aus und ganz anderswohin, sie bilden vielschichtige Texturen, die schwerelos über den Seiten zu schweben scheinen oder im Gegenteil wie Blei ins Papier gegossen sind. Mit fiebriger Neugierde irrt der Blick durch zwei- und dreidimensionale Labyrinthe ohne Ausweg, durch symmetrische Gesichter und asymmetrische Objekte, durch abstrakte Symbole und beängstigende Räume, mal leer, mal vollgestrichelt.
«Le fils du roi» lebt von den Bildern. Umso interessanter und bedeutsamer ist deshalb, dass Eric Lambé sein Spektakel ausgerechnet und ausschliesslich mit billigen Kugelschreibern inszeniert hat, dem wohl bescheidend-sten und unprätentiösesten Schreibutensil überhaupt. Mit dem Kugelschreiber malt und zeichnet man nicht, mit dem Kugelschreiber schreibt man. Die meisten tun das jedenfalls, bis auf Lambés Frémok-Kollegin Dominique Goblet – auch sie eine Virtuosin des Kugelschreibers – und viele Art-Brut-Künstler, für die der Kugelschreiber wegen seiner Verfügbarkeit ein naheliegendes Werkzeug ist. Auch diese Schnittstellen – zum Schreiben und zur Art Brut – sucht Lambé auf, auch wenn seine Bilder bei aller manischen Ausstrahlung in Wahrheit virtuos und sehr bewusst artikuliert und durchkomponiert sind.
«Le fils du roi» ist ein Meisterwerk. Es ist auch der heute wieder einmal notwendige Beweis, dass der Comic zwar eine grossartige Ausdrucksform zum Erzählen interessanter Geschichten ist – aber nicht nur: Man kann auch eigenwillige, eindrückliche, faszinierende, atmosphärische, dichte Bildwelten schaffen, die ohne eindeutig nachvollziehbaren Plot aussagekräftig und bereichernd sind.
Christian Gasser
- Eric Lambé: «Le fils du roi».
- Frémok Editions, 90 S., Hardcover, farbig,
- Euro 33 / sFr. 45.–
Zeina Abirached: «Das Spiel der Schwalben»

Kammerspiel im Bürgerkrieg
Die libanesische Zeichnerin Zeina Abirached ist ein Kind des Krieges. Ihre Heimatstadt Beirut befand sich von 1975 bis 1990 im Kriegszustand und war auch danach immer wieder Kampfhandlungen ausgesetzt – zuletzt im Jahr 2006. Abiracheds Kindheit ist geprägt davon. 1981 geboren, wohnte sie in unterschiedlichen Häusern, musste mit ihren Eltern in immer neue Wohnungen wechseln, weil die vorherige zerstört wurde. Ihr Comic «Das Spiel der Schwalben» umkreist diese Lebensumstände eindrucksvoll. Auf der Ebene der erzählten Zeit auf nur einen Abend konzentriert, flechtet Abirached kunstvoll die Situation im Ganzen ein: Während sie zusammen mit ihrem kleinen Bruder auf die Eltern wartet, die zwei Strassen weiter bei der Grossmutter sind, versammeln sich nach und nach alle Hausbewohner im Wohnungsflur der Abiracheds. Dieser Flur ist der sicherste Ort des Hauses und wird allabendlich von den Nachbarn aufgesucht. Er ist zugleich der letzte bewohnbare Raum der einst grossen Wohnung der Abiracheds. Dort erzählt die illustre Gesellschaft von früher, vom Krieg und von ihren Plänen, während die Angst um Zeinas Eltern und der Klang der Granaten für Anspannung sorgen.
So wenig wie Zeina Abirached mit ihrem lakonischen Kammerspiel inmitten eines tobenden Bürgerkrieges auf eine akkurate Abbildung der chaotischen Zustände in der libanesischen Millionenstadt abzielt, so wenig will sie das auf der Bildebene. Ihre kontrastreichen Zeichnungen umspielen die Absurditäten des Krieges mit ornamentalen Entwürfen, die den Krieg wie ein absurdes Brettspiel anmuten lassen. Passend dazu erzählt der Comic mit trockenem Humor vom Schrecken. Das und die Schwarzweiss-Zeichnungen haben Abirached schon viele Vergleiche mit Marjane Satrapis «Persepolis» eingebracht. Aber wo Satrapi den grossen Bogen spannt, geht sie ins kleinste Detail. Und wo Satrapi betont kindlich zeichnet, wird Abirached symbolhaft. Beide Ansätze sind auf ihre ganz eigene Weise geprägt von der subjektiven Sicht eines jungen Menschen auf einen nur schwer begreifbaren Irrsinn.
Christian Meyer
- Zeina Abirached: «Das Spiel der Schwalben».
- 182 S., s/w, Softcover,
- Euro 19.95 / sFr. 28.40
Glyn Dillon: «The Nao of Brown»
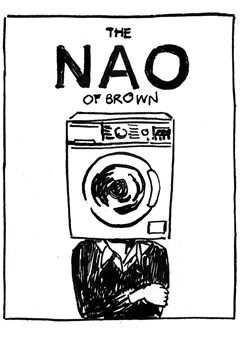
Waschmaschine im Schleudergang
Nao Brown arbeitet und lebt in London als Illustratorin und Teilzeitangestellte in einem Geschäft für japanisches Design-Spielzeug. Sie ist halb Britin, halb Japanerin (eine sogenannte «hafu») und leidet an einer Zwangsstörung, die sich in Mordfantasien ausdrückt. Mit einer Art Richterskala bewertet sie jeweils das Ausmaß ihrer Neurose («acht von zehn», denkt sie und bricht dem Taxifahrer in Gedanken das Genick). Objekte wie Kugelschreiber machen ihr Angst, jeden Augenblick befürchtet sie damit Menschen in ihrer Nähe zu erstechen. Die Scham vor diesen Gedanken ist erheblich, noch größer ist allerdings die Angst, dass sich die Fantasien in Realität verwandeln. Was ihre Krankheit in Schach hält sind Meditationsstunden, das kontemplative Zeichnen von Kreisen, die an eine Waschmaschine im Schleudergang erinnern und die Liebe für japanische Spielzeugfiguren, die der Autor liebevoll über das ganze Buch verstreut. Nao lebt zurückgezogen und sehnt sich nach der großen Liebe. Diese glaubt sie in Gregory zu finden, einem Bären von einem Mann, der sich als Waschmaschinenmonteur, Philosoph und Trinker betätigt und der Naos Lieblingsfigur aus dem fiktiven Manga «Ichi» ähnlich sieht. Obwohl das Verhältnis zwischen den beiden kompliziert ist, lernt Nao, sich selbst und ihre Umgebung zu akzeptieren.
Der Brite Glyn Dillon begann seine Karriere als Comic-Zeichner, entwickelte dann Storyboards für Film und Fernsehen und hat nun seinen ersten Comic-Roman veröffentlicht. Dillons Stärke liegt in seinen mit Wasserfarben gemalten detailgetreuen Bildern und der starken Charakterisierung der Hauptfiguren. Unheimlich sind die Augenblicke, in denen die fragil wirkende Nao sich in eine Mörderin verwandelt. Figuren wie Naos bester Freund Steve oder der sanfte Gregory wachsen einem ans Herz. Umso ärgerlicher sind die teilweise abgegriffenen Geschichten und die buddhistischen Weisheiten, die Nao und Gregory von sich geben. Szenen aus Naos Lieblings-Manga über ein Baumwesen namens Piktor (zeichnerisch an Moebius und den Anime-Regisseur Miyazaki angelehnt) soll als Parabel verstanden werden, zieht jedoch die Geschichte unnötig in die Länge. Denn Glyn Dillon vermag mit seinen Bildern mehr auszusagen als mit seinen Worten.
Giovanni Peduto
- Glyn Dillon: «The Nao of Brown».
- SelfMadeHero, 208 S., Hardcover, farbig,
- £ 16.99.
Pat Grant: «Blue»
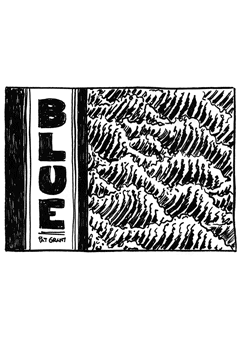
Surfen mit Ausserirdischen
Der Erzähler in «Blue», einem Comic des Australiers Pat Grant, ist ein unbeschwert in den Tag hinein lebender «Bogun», eine Art australischer Redneck, der uns mit manchmal subtilen, manchmal eher schlüpfrigen Erinnerungen aus den «guten alten Zeiten» seiner Kindheit in der fiktiven Hafenstadt Bolton erzählt, vom Abhängen im Drugstore an der Ecke und vom Schule-Schwänzen, wann immer die grossen Wellen an den Strand donnerten. Die Geschichte dreht sich einerseits um den Tag, an dem der Erzähler und seine Kumpels sich aufmachen, die Leichenteile zu suchen, die nach einem Unfall entlang der Eisenbahnstrecke verstreut sein sollen, andererseits um die Jahre, als die «gute alte Zeit» plötzlich nicht mehr so gut ist, weil eine Gruppe von Einwanderern in die Stadt zieht. Fremde, «Aliens», die sich nicht anpassen wollen.
In «Blue» sind die Fremden tatsächlich Ausserirdische: schräg aussehende, mit mehreren Beinen ausgestattete Neuankömmlinge, die merkwürdige Teigwaren essen, rätselhafte Graffiti an die Wände malen und sich niemals in die Gemeinschaft der Alteingesessenen einfügen werden. «Blue» lässt offen, woher die nicht wirklich menschlich wirkenden Lebewesen kommen, und auch, wer sie sind. Überhaupt tauchen sie in den Bildern gar nicht oft auf, was der Geschichte einen speziellen Reiz gibt. Dieser Comic ist sehr dynamisch gezeichnet (er erinnert an Jim Woodring, Dave Cooper, Roger Langridge oder an japanische Holzschnitte) und hervorragend erzählt. Es geht um das Heranwachsen, um soziale Veränderungen, Klassenunterschiede, Rassenprobleme und speziell auch um Erinnerung und Reue. Grant schafft es, komplexe Themen wie Immigration und Fremdenfeindlichkeit zu behandeln, ohne dabei die Weltsicht seines ziemlich rassistischen Erzählers zu denunzieren oder polemisch zu werden.
«Blue» ist ein gut durchdachtes Buch eines intelligenten Künstlers, der geschickt den Fettnäpfchen ausweicht, in die andere Jungautoren gerne treten. Noch Tage nach der Lektüre tauchen Fragmente aus seiner Geschichte im Kopf des Lesers auf und erinnern ihn daran, wie souverän Grant schwierige Themen mit leichter Hand zu Papier bringt. Der Titel des Buches hingegen gibt Rätsel auf – bezieht sich «Blue» auf die Hautfarbe der Ausserirdischen, die Farbe der Wellen oder die Stimmung des Erzählers, als er sich an seine Jugend erinnert?
Grant beweist sein Erzähltalent auch im klugen Essay hinten im Buch, einem revisionistischen Abriss der angloamerikanischen Comic-Geschichte aus der Perspektive eines jugendlichen Surfers der zwischen 1975 und 1985 geborenen «Generation Y», aufgewachsen auf der anderen Seite der Welt. Grant hat auch ein paar eher unkonventionelle Ideen bezüglich Copyright und erklärt uns im Anhang, warum er sich entschlossen hat, «Blue» auf seiner Website kostenlos in ganzer Länge zu zeigen. Aber da der Verlag Top Shelf ein derart schön gestaltetes Buch gemacht hat, wäre es jammerschade, nicht die Papier-Version zu kaufen.
Mark David Nevins
- Pat Grant: «Blue».
- Top Shelf Books, 96 S., Hardcover, dreifarbig (grau, braun, blau),
- ca. 20 Dollar
Vivès/Ruppert&Mulot: «La Grande Odalisque»

Über den Dächern des Louvre
Für einen actiongeladenen Comic über einen spektakulären Kunstraub hat sich das französische Duo Ruppert & Mulot (deren Werk «Affentheater» bei Edition Moderne erschienen ist) mit dem Autor und Zeichner Bastien Vivès («Der Geschmack von Chlor», «Polina») zusammengetan. Entstanden ist eine bissig schwarze Komödie über eine vertrackte Frauenfreundschaft, gespickt mit Stunts und Schießereien. Angelehnt an Kriminalfilme wie Hitchcocks «To Catch a Thief» (mit einer Prise Tarantino) oder Tsukasa Hojos Manga-Serie «Cat’s Eye» erzählt «La Grande Odalisque» die Geschichte der Einbrecherinnen Alex und Carole, die renommierte Kunstmuseen mit professionellem Geschick, technischen Hilfsmitteln und akrobatischer Leistung ausrauben. Wenn sich Alex während eines Einbruchs im Musée d’Orsay mit ihrem Ex-Freund am Telefon streitet und Carole um Rat bittet, wird klar: Ein Meisterwerk wie Manets «Frühstück im Freien» zu stehlen, ist für die beiden reine Routine. Spaß an ihrer Arbeit finden sie aber, wenn es brenzlig wird. Darum können sie ihren nächsten Auftrag nicht ablehnen: Sie sollen im Louvre die «Große Odaliske» des Franzosen Ingres stehlen bzw. – wie Alex bemerkt – das Gemälde mit dem «Mädel mit dem langen Rücken» (das Gemälde ist unter anderem bekannt für die unrealistischen Körperproportionen der abgebildeten Haremsdienerin). Für dieses Unterfangen benötigen sie einen ausgeklügelten Plan und eine zusätzliche Hilfskraft wie die Motorrad-Akrobatin Sam. Es ist eindrücklich, wie den Autoren mit einfachen Mitteln gelingt, den Leser in ein fulminantes Finale mitzureißen. Kein Heist-Movie ist spannender. «La Grande Odalisque» ist eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Ruppert & Mulot – zuständig für Kulisse und Figuren – und Vivès, der den drei Frauen ein hübsches Gesicht mit einer weniger gelungenen Mimik verpasst hat. Auch wenn die Gestaltung weniger rebellisch und innovativ ausfällt als Ruppert & Mulots ältere Werke, ist es vielleicht Vivès’ Einfluss zu verdanken, dass aus diesem Buch ein unterhaltender Action-Autoren-Comic geworden ist.
Giovanni Peduto
- Vivès / Ruppert & Mulot: «La Grande Odalisque».
- Aire Libre, 122 S., Hardcover, farbig,
- Euro 20 / sFr. 30.90
- Vivès / Ruppert & Mulot: «Die Grosse Odaliske».
- Reprodukt, in Bearbeitung, 128 S., farbig,
- Euro 18
Y.Tatsumi: «Geliebter Affe und andere Offenbarungen»

Manga der anderen Art
Yoshihiro Tatsumi ist ein Manga-Zeichner, der überhaupt nicht dem im Westen vorherrschenden Manga-Klischee entspricht. Der u. a. mit zwei Eisner Awards geehrte Ausnahme-Manga-Zeichner widmet seine Geschichten menschlichen Tragödien, deren Protagonisten sich zwar mitten in der menschlichen Gesellschaft befinden, aber aufgrund ihrer geheimen Vorlieben, Obsessionen oder Neigungen eigentlich abseits dieser stehen. «Geliebter Affe und andere Offenbarungen» versammelt Kurzgeschichten, die in den Jahren von 1970 bis 1990 erschienen sind. Dabei blickt Tatsumi unter die Oberfläche der japanischen Gesellschaft und präsentiert ein realistisches sowie ungeschöntes Bild ihrer Mitglieder. Tatsumi ist der Erfinder der «Gekiga», der Manga für Erwachsene. Ermutigt dazu wurde er von Osamu Tezuka persönlich, der in der gleichen Stadt wie Tatsumi gelebt hat, nachzulesen in seinem sehr zu empfehlenden autobiographischen Manga «Gegen den Strom». Tatsumi präsentiert ein verstörendes Bild der japanischen Gesellschaft, das sich aber im Grunde nicht unterscheidet von westlichen urbanen Kulturen. In Tatsumis Kurzgeschichten spiegeln sich die Traumata Japans wider: der Atombombenabwurf, die chinesische und amerikanische Besatzung, und vor allem der schnelle Wandel von einer traditionellen Agrar- hin zu einer modernen Industriegesellschaft. Wobei in Japan die Moderne nie völlig die Tradition verdrängen konnte. Aber wahrscheinlich genau aus diesem Grunde ist die westliche Kulturlandschaft so fasziniert von Japan, von dieser Ambivalenz, die sich auch in Tatsumis Manga findet. «Geliebter Affe» ist ein schockierendes Sittengemälde einer Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruches, von der wir uns im Westen nicht weit entfernt befinden.
Matthias Schneider
- Yoshihiro Tatsumi: «Geliebter Affe und andere Offenbarungen».
- Carlsen Verlag, 320 S., Softcover, s/w,
- Euro 19.90 / sFr. 28.50
Franziska Walther & Kurt Tucholsky

Klassiker neu entdecken
Die mehrfach ausgezeichnete Illustratorin und Buchgestalterin Franziska Walther hat sich einem Klassiker der deutschen Literatur gewidmet, nämlich Kurt Tucholsky. Manch einer wird nun zusammenzucken, denn er wurde in der Schule mit den Texten zur Genüge malträtiert. Es lohnt sich aber, diese besondere Publikation zu beachten. Erst recht, wenn man Tucholsky kaum oder gar nicht kennt. Denn Walther hat vier der sicherlich schönsten und bissigsten Texte Tucholskys ausgewählt, um sie mit ihren visuell starken und farbenprächtigen Illustrationen zu kombinieren. Tucholsky hat die Kurzgeschichten unter den Pseudonymen Ignaz Wrobel, Theobald Tiger, Peter Panter und Kaspar Hauser veröffentlicht, um in einer jeden in eine andere Rolle schlüpfen zu können. Er kritisiert äusserst humorvoll und pointiert Kirche und Staat, stellt Werte und Moral der menschlichen Gesellschaft in Frage und ermutigt den Leser, sich über Konventionen hinwegzusetzen. Tucholskys Texte haben an Aktualität nichts eingebüsst, im Gegenteil, wenn man z. B. «Die Zeitsparer» liest, erschrickt man über die Vorahnung des Schriftstellers bezüglich gesellschaftlicher Entwicklungen. Virtuos nimmt Walther die künstlerische Besonderheit Tucholskys auf und lässt sie in ihre Zeichnungen einfliessen. Surreale und absurde Darstellungen unterstreichen die Aussagen von Tucholskys Texten, unterwerfen aber das geschriebene Wort nicht dem Bild, sondern führen es weiter und ergänzen es um eine weitere Ebene. «Der Zeitsparer» ist ein Buch, das den Leser einen Klassiker neu entdecken lässt. Und zwar auf eine solch ansprechende visuelle Art, dass man das Buch gar nicht mehr aus den Händen legen möchte, sondern immer wieder die äusserst gelungene Verbindung von Wort und Illustration bestaunt. Sehr empfehlenswert!
Matthias Schneider
- Franziska Walther (Ill.) & Kurt Tucholsky: «Der Zeitsparer. Grotesken von Ignatz Wrobel».
- Kunstanst!fter Verlag, 104 S., Hardcover, farbig,
- Euro 18 / sFr. 25.90
Lise Myhre: «Nemi. Band III»
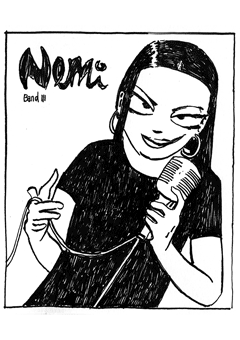
Gothic Girl
Fünf Jahre mussten die Fans von Lise Myhres Gothic-Girl Nemi auf einen neuen Band warten. Warum, ist nicht so ganz klar, zumindest ein Teil des enthaltenen Materials scheint nämlich schon älter zu sein. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die norwegische Serie im deutschsprachigen Raum immer noch relativ unbekannt ist. Das, obwohl Nemi nicht nur in ihrem Heimatland seit ihrer Entstehung 1997 stetig erfolgreicher geworden ist. Mittlerweile erscheinen Nemi-Strips in etwa 150 europäischen Tageszeitungen und Magazinen, in Norwegen erscheint ausserdem eine nach ihr benannte monatliche Comic-Anthologie, und in ganz Skandinavien ist Nemi längst zum Klassiker geworden.
Über die Jahre haben sich weder die Serie noch die Titelfigur wesentlich verändert: Nemi ist weiterhin zu Hause in ihrer Welt aus 80er-Jahre Heavy Metal, Fantasy-Romanen, Kneipen-Touren und einer grossen Leidenschaft für Süsskram. Und ebenso steht ihr immer noch ihre beste Freundin Cyan – ihre Verbindung zur Welt der «Normalos» – zur Seite. Vielleicht gibt es im dritten Band etwas weniger Szene- und «Nerd»-Themen und mehr Alltagsgeschichten. Andererseits hat Nemi immer schon viel Witz daraus gezogen, dass sich auch ein weiss geschminktes und schwarz gekleidetes Metal-Girl mit alltäglichen Problemen herumschlagen muss, wie der Steuererklärung, Shopping-Sucht und Macho-Gehabe. Ein deutlicher Unterschied zu den älteren Geschichten ist dagegen, dass hier nicht mehr immer nur auf eine Pointe zugesteuert, sondern zwischendurch auch mal über das Leben philosophiert wird. Nemi scheint also doch etwas älter geworden zu sein.
Besonderen Charme verleihen der Serie aber auch die tollen Zeichnungen. Besonders, wie Nemi aus ihrer unnahbaren, kühlen Art plötzlich in extreme Gefühlsausbrüche wie absolute Verzückung oder grenzenlosen Zorn verfallen kann – und so selbst ihre Coolness untergräbt – ist mit wunderbar übertriebener Mimik dargestellt, die an klassische Cartoons oder stellenweise sogar Manga erinnert. Lise Myhre stellt überhaupt die verschiedensten Dinge mit ihrer Titelheldin an: Auf ganzseitigen Zeichnungen, die immer wieder zwischen den Comic-Strips eingebaut sind, erscheint Nemi auch mal als Spinnenfrau, Kriegerin oder Tarot-Karte.
Nicht nur Metal- und Fantasy-Fans, sondern auch so ziemlich alle anderen, die darüber hinwegsehen können, dass nicht jede Pointe zündet oder ein Strip auch mal purer Nonsens ist, dürfte dieser Band bestens unterhalten. Höchste Zeit, dass Nemi auch hierzulande mehr Beachtung findet.
Jan Westenfelder
- Lise Myhre: «Nemi. Band III».
- Ubooks, 144 S., Hardcover, s/w,
- Euro 14.95 / ca. sFr. 22.–
Kurz und Gut
von Christian Meyer
- Li Kunwu & Philippe Otié: «Ein Leben in China».
- Edition Moderne, 256 S., Softcover, s/w, Euro 24 / sFr. 29.80
Derf Backderf war zu Schulzeiten ein Freund von Jeffrey Dahmer. Dahmer erlangte später eine traurige Berühmtheit, weil er zwischen 1978 und 1991 17 Menschen ermordete und teils verspeiste. In «Mein Freund Dahmer» blickt Backderf auf die gemeinsame Schulzeit zurück und schildert einen vernachlässigten, einsamen Jungen, der früh abnorme Interessen entwickelt. Backderfs karikaturhafter Zeichenstil steht weder der Tragik noch dem Grauen im Weg.
- Derf Backderf: «Mein Freund Dahmer».
- Metrolit, 224 S., Softcover, s/w, Euro 22.99 / sFr. 34.90
Nach «Trommelfels» bestätigt Marijpol mit «Eremit» ihre Sonderstellung als Künstlerin: Sie entfaltet ein fantastisches Szenario einer überalterten Gesellschaft, in der die wenigen Kinder wie Kaiser hofiert werden. Die Alten dürfen sich im Gegenzug einen schönen Tod im Reisebüro bestellen. Ein Eremit stellt ihnen kurz zuvor die Gewissensfrage, ob sie es ernst meinen. Zweifel haben die Kandidaten selten, der Eremit hingegen wird schon sein ganzes Leben so sehr von Zweifeln gepeinigt, dass sich gar sein Kopf spaltet. Als ein Alter sich dem Tod verweigert und ein überbehütetes Kind entflieht, gibt es auch für den Eremiten eine Chance auf inneren Frieden. Faszinierend, brutal und symbolträchtig.
In Sachen verspielter Brutalität steht «Die Insel der 100.000 Toten» dem in nichts nach. Fabien Vehlmann erzählt von einem Mädchen, das ihren Vater sucht und dabei auf einer Pirateninsel mit einer Schule für angehende Henker landet. Die Kombination aus niedlich-naiv und abgeklärt-brutal ist so überraschend wie erschütternd. Jason, der hier erstmals mit einem Autor zusammenarbeitet, liefert dazu seine schlichten Farbzeichnungen.
- Marijpol: «Eremit».
- avant-verlag, 150 S., Softcover, s/w, Euro 19.95 / sFr. 28.40
- Jason & Fabien Vehlmann: «Die Insel der 100.000 Toten».
- Reprodukt, 56 S., Softcover, farbig, Euro 15 / sFr. 21.90
«Böse Geister» erzählt von einem älteren Mann, der in sein altes Viertel zurückkommt, als er erfährt, dass es abgerissen werden soll. Im verlassenen Haus seiner Kindheit kommen Erinnerungen an die Nachkriegszeit hoch, mit ehemaligen Nazis als Lehrern und Comics, die als Schund galten. Peer Meter und Gerda Raidt ist ein atmosphärisches Zeitporträt gelungen, das raffiniert Spannungsmomente setzt.
- Peer Meter & Gerda Raidt: «Böse Geister».
- Reprodukt, 104 S. Hardcover, s/w, Euro 20 / sFr. 28.90
«Die Frau ist frei geboren» erzählt die Geschichte von Olympe de Gouges, jener frühen Feministin, die schliesslich von Robbespierres Terrorregime zum Tode verurteilt wurde.
José-Louis Bocquet erzählt de Gouges’ bewegtes Leben und ihren Kampf für die Gleichberechtigung auf 400 Seiten. Die vielen Personen und politischen wie gesellschaftlichen Hinter gründe machen dennoch einen 50-seitigen Anhang nötig. Wie schon in dem ungewöhnlichen Frauen-porträt «Kiki de Montparnasse» steuert auch hier Catel Muller ihre schwungvollen Schwarzweiss-Zeichnungen bei.
- Catel Muller & José-Louis Bocquet: «Die Frau ist frei geboren».
- Splitter, 480 S., Hardcover, s/w, Euro 36.80 / sFr. 48.90
Joann Sfar spinnt in «Chagall in Russland» eine fiktive Biographie, welche die Künstlerwerdung des jungen Marc mit einer unglücklichen Liebesgeschichte und den Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung verbindet. Das Porträt aus dem Russland der Jahrhundertwende ist wild und farbenfroh, so brutal wie vital, und letztendlich so humanistisch und lebensbejahend, wie man es auch aus seinem Musiker-Abenteuer «Klezmer» kennt. Mit dem vierten Band «Trapezschwünge» von «Klezmer» verfolgt Joann Sfar weiterhin das Schicksal eines Klezmer-Ensembles im Russland des frühen 20. Jahrhunderts. In Odessa angekommen, landet die Truppe in einem Zirkus, und Sfar nutzt das Ambiente, noch mehr als bisher, um das Leben in all seinen Facetten mit wilden Zeichnungen, Liebe und Gewalt zu zelebrieren.
- Joann Sfar: «Klezmer: Trapezschwünge».
- avant-verlag, 120 S., Softcover, farbig, Euro 19.95 / sFr. 28.40
- Joann Sfar: «Chagall in Russland».
- avant-verlag, 128 S., Softcover, farbig, Euro 19.95 / sFr. 28.40
Nach Thomas Bernhards «Alte Meister» nimmt sich Nicolas Mahler nun gleich zwei Vorlagen auf einmal vor: «Alice in Sussex» verknotet Lewis Carrolls «Alice in Wonderland» mit «Frankenstein in Sussex» des Österreichers H. C. Artmanns, der ja schon Alice mit Mary Shelleys Monster verband. Also Zitat hoch zwei, was Mahler da in seinem gewohnt trocken-humorigen Minimalismus betreibt.
«Der Anfang vom Ende» ist ein 1995 von Marc-Antoine Mathieu konzipiertes Erzählexperiment, das vorne wie hinten begonnen werden kann und in der Mitte zusammenfindet. Es ist der letzte Band der kafkaesken Vexierspiele um den Angestellten Julius Corentin Acquefacques, der nun wieder vorliegt.
- Nicolas Mahler: «Alice in Sussex».
- Suhrkamp, 144 S., Softcover, s/w, Euro 18.99 / sFr. 27.50
- Marc-Antoine Mathieu: «Der Anfang vom Ende».
- Reprodukt, 52 S., Softcover, s/w, Euro 12 / sFr. 17.90
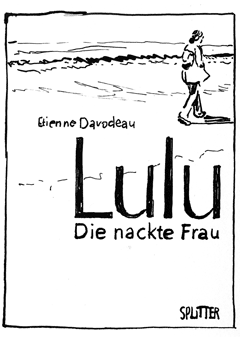
Étienne Davodeau widmet sich in «Lulu – die nackte Frau» dem Ausbruch einer Frau um die 40. Drei Kinder hat sie und einen aggressiven, trinkenden Mann. Einer plötzlichen Eingebung folgend, kehrt sie nach einem ernüchternden Vorstellungsgespräch nicht mehr heim. Stattdessen macht sie etwas, was sie seit 15 Jahren nicht mehr getan hat: Sie denkt an sich und tut, was ihr gefällt. Das löst in ihrem Umfeld allerlei Chaos aus. Davodeau erzählt in kunstvollen Rückblenden und realistischen Farbzeichnungen (Splitter).
- Étienne Davodeau: «Lulu – die nackte Frau».
- Splitter, 159 S., Hardcover, farbig, Euro 24.80 / sFr. 35.40
Die von Sascha Hommer herausgegebene Anthologie «Orang» ist bei ihrer zehnten und leider auch letzten Ausgabe angelangt. Fantastisch geht es auch hier zu: Unter dem Thema «Heavy Metal» versammelt der Band Arbeiten von Anke Feuchtenberger, Aisha Franz, Martina Lenzin, Marijpol, Verena Braun oder Sascha Hommer, die sich mal konkret, mal abstrakt, mal assoziativ mit dem Thema beschäftigen.
- Sascha Hommer (Hg.): «Orang 10: Heavy Metal».
- Reprodukt, 172 S., Softcover, farbig & s/w, Euro 18 / sFr. 25.90
