No: 115
114<|>116
REPORTAGEN
TITELBLATT / Olivier Kugler
AUF DER SUCHE NACH EINEM THEMA / Mazen Kerbaj
AUF DER LANGEN BANK / Christoph Fischer
INTERNET – WO BIST DU DEN ZUHAUSE? /
Martin Panchaud
JOHN ATEIKU, EIN FISCHER IN GHANA / Olivier Kugler
FACE B / Arnaud le Gouëffl ec und Marion Mousse
PARKING / Zhang Xun
GANGNAM STYLE / Patrick Chappatte
DIE WERKSTATT DER GÖTTER /
Harsho Mohan Chattoraj
WER WILL RAINER BÖHLKES GELD? / Ulli Lust
BUENOS AIRES / Eugen U. Fleckenstein
ASCHE ZU ASCHE / Julia Bruderer
EDITORIAL
30 Jahre STRAPAZIN
Ich selber liebe vor allem Comic-Reportagen, weshalb mir das vorliegende Heft besonders am Herzen liegt, auch wenn nicht alle Beiträge lupenreine journalistische Reportagen sind, wie sie z.B. im Magazin Reportagen (www.reportagen.com) abgedruckt werden, mit dem wir die Ehre haben, für diese Ausgabe zusammenzuarbeiten und aus dessen aktueller Nr. 17 wir zum ersten Mal in der Geschichte von STRAPAZIN einen längeren Textbeitrag abdrucken, den Text von Gabriel García Márquez . Aus der ganz dem Reportage-Comic gewidmeten französischen Zeitschrift La Revue Déssinée (www.larevuedessinee.fr), mit deren Herausgeber Franck Bourgeron sich unser Comic-Kritiker Christian Gasser unterhalten hat, stammt die amüsante Geschichte über Lee «Scratch» Perry von Gouëfflec und Mousse, die von Jamaica bis in die Schweiz führt. «Die Werkstatt der Götter» von Harsho Mohan Chattoraj ist im Heft, weil ich letztes Jahr in Kolkata, Indien, weilte und mit Harsho einen spannenden Abstecher ins Stadtviertel Kumartuli unternahm, wo aus Stroh und Lehm Hindu-Gottheiten entstehen. Martin Panchaud, ein junger Genfer, der seit kurzem im STRAPAZIN-Atelier arbeitet, geht auf formal unkonventionelle Art dem «Wohnort» des Internet nach; Patrick Chappatte, der Grandseigneur des Reportage-Comics, den im Heft zu haben wir ganz besonders schätzen, recherchierte in Südkorea zum Thema Musik; Zhang Xun hingegen blieb an seinem Wohnort in Nanjing, China, einer im Autoverkehr erstickenden Stadt und berichtet von den Bestrebungen seiner Nachbarn, die letzten Grünflächen zu erhalten. Eine andere gute Bekannte ist Ulli Lust; sie schreibt und zeichnet über ihre Nachforschungen auf der Spur geheimnisvoller Briefe von eventuellen Hochstaplern. Eher ein Tiefstapler ist Olivier Kugler, dessen mit leichter Hand hingetuschten Geschichten – sei es jener über die Arbeitselefanten in Laos (erschienen bei Edition Moderne) oder derjenigen in diesem Heft über das Fischerdorf Butre in Ghana – man kaum ansieht, wie viel Arbeit vor Ort dahintersteckt. Eugen U. Fleckenstein, aus dem Kreis der STRAPAZIN-Gründer stammend, lässt uns an seinem Aufenthalt in Buenos Aires teilnehmen; Christoph Fischer, beeindruckend bereits als Autor von «Teufelskreisel Kreuzstutz» im STRAPAZIN Nr. 92, hat eine Langzeitstudie über die Menschen auf dem Luzerner Bahnhofplatz verfasst; der libanesische Musiker und Zeichner Mazen Kerbaj sinniert über die Schwierigkeiten, ein Thema für eine Reportage zu finden, und Julia Bruderer, eine aufstrebende Schweizer Künstlerin, verbrachte mehrere Tage in einem Zürcher Krematorium, wovon der Bericht «Asche zu Asche» handelt.
Ihnen allen möchte ich sehr herzlich für ihre Bereitschaft danken, uns ihre Geschichten zu überlassen, obwohl wir noch beinahe dieselben tiefen Honorare bezahlen wie 1984, als alles anfing. Mit dem Unterschied, dass die Redaktion sich heute mit Prosecco bei Laune hält, der keine Flecken auf Originalvorlagen hinterlässt.
Christoph Schuler

LA REVUE DESSINEE
Die Vorteile der Langsamkeit
Als sich die Gründer von La Revue Dessinée im Januar 2013 am internationalen Comicfestival von Angoulême an einer Pressekonferenz vorstellten, war das Interesse gross, aber nicht minder gross war die Skepsis: Eine vierteljährliche Reportage-Zeitschrift, die ausschliesslich Comics anbietet? Kann das funktionieren?
Im Herbst 2013 erschien dann die erste Ausgabe, und die Reaktionen waren überwältigend. Zweimal musste nachgedruckt werden, und die folgenden Ausgaben erschienen in einer Startauf-lage von 20 000 Exemplaren. Offenbar stillt diese Zeitschrift ein grosses Bedürfnis im Comic-Land Frankreich: Das Bedürfnis nach einer anderen Form von Journalismus und einer anderen Form von Comics.
Die drei Ausgaben, die jeweils 224 Seiten dick und durchgängig farbig gedruckt sind, bieten eine grosse Bandbreite an Inhalten und Stilen an. Inhaltlich liegt der Fokus auf lokalen und regionalen Themen, formal auf der Sprache des Comics – andere Formen der gezeichneten Reportage finden in La Revue Dessinée kaum Platz. Das verstärkt zwar den Eindruck von Dichte und Stringenz, führt aber auch zu einer gewissen Gleichförmigkeit im Erzählen. Abgesehen von diesem leisen Vorwurf ist La Revue Dessinée ein faszinierendes Projekt, dessen Erfolg hoffentlich auch hierzulande eine gewisse Wirkung zeitigt.
Um die Erfolgsgeschichte von La Revue Dessinée zu verstehen, unterhielt sich Christian Gasser mit dem Mitgründer und Herausgeber Franck Bourgeron.
Wann und wie ist die Idee zu La Revue Dessinée entstanden?
Franck Bourgeron: Das war vor knapp drei Jahren. Wir waren eine kleine Gruppe frustrierter Comic-Autoren. Wegen der Krise wurde es immer schwieriger, Verlage für ungewöhnliche eigene Projekte zu interessieren. Ausserdem hatten wir das Bedürfnis, aus der Routine der Albenproduktion auszubrechen. Wir wollten uns als Comic-Autoren neu erfinden, und das am liebsten mit einem gemeinsamen Projekt, um der Einsamkeit des Comic-Zeichnens zu entfliehen. Es ist kein Zufall, dass zur selben Zeit andere kollektive Projekte lanciert wurden – das Unbehagen und die Unzufriedenheit unter den Comic-Zeichnern unserer Generation war gross. Für uns war es rasch klar, dass wir uns der Comic-Reportage zuwenden wollten. Ich liebe die News, ich liebe die Geschichte, ich liebe das Dokumentarische, ich liebe die Zeichnung. Ein paar von uns, Kris und Sylvain Ricard etwa, hatten bereits Erfahrungen als Comic-Reporter gesammelt. Bald stiess auch ein Journalist, David Servenay, zu uns. Bis zum Erscheinen der ersten Nummer dauerte es zwei Jahre, eine eigentlich kurze Zeit, die uns aber viel zu lang erschien – für uns konnte nichts schnell genug gehen.
Schöne Ideen gibt es viele, aber wie finanziert man sie in Krisenzeiten?
FB: Die Finanzierung von La Revue Dessinée war einfacher als erwartet. Die Reaktionen waren von Anfang an sehr positiv. Wir gründeten eine Aktiengesellschaft, in die neben vielen Privaten auch der Verlag Futuropolis investierte. Eine Crowd-Funding-Aktion brachte nicht nur einiges an Geld ein, sondern auch Abonnenten: Noch vor dem Erscheinen der ersten Nummer hatten wir 400 Abonnenten. Dieser überschwängliche Empfang unserer Idee überzeugte uns von ihrem Potenzial.
Der Leichtsinn unserer Anfänge
Hat Euch der Erfolg der zwei ersten Nummern überrascht? Was für eine Auflage strebt Ihr mittelfristig an?
FB: Trotz des grossen Interesses überraschte uns der Erfolg. Die erste Nummer mussten wir zweimal nachdrucken, von der zweiten druckten wir gleich 20‘000 Exemplare. Längerfristig benötigen wir, um eine minimale Stabilität zu erreichen und um allen Mitarbeitenden Honorare zahlen zu können, eine Auflage von 12‘000 Exemplaren. Im Moment finanziert sich La Revue Dessinée durch die Einnahmen. Vermutlich ist das Interesse am Anfang besonders hoch – wir hoffen aber, dass sich unsere Auflage bei 15‘000 Exemplaren und möglichst vielen Abonnenten einpendelt. Das mag ehrgeizig sein, aber ein bisschen Ehrgeiz kann nicht schaden.
Aufällig ist Euer Verzicht auf Werbung. Könnt Ihr Euch das leisten?
FB: Das war der Leichtsinn unserer Anfänge… – Wir verstehen uns als eine Comic-Zeitschrift mit einer klaren grafischen Handschrift und einer klaren Autorenhaltung. Wir empfänden es als widersinnig, unser grafisches Konzept mit Werbung für Autoreifen und Waschmaschinen zu unterlaufen.
Wie erklärt Ihr Euch Euren Erfolg?
FB: Die Leser verlangen nach einer neuen Art von Presse, die andere Inhalte anders vermittelt. Die klassische Presse – die Tageszeitung und die News-Magazine – stecken in einer Krise. Dieses Konzept scheint überholt zu sein. Es wird bedroht von den audiovisuellen Medien und vom Internet – doch deren ununterbrochener Informationsfluss ist auf die Dauer ermüdend und wenig befriedigend. La Revue Dessinée hingegen erlaubt einen neuen Blick auf die Aktualität, einen langsamen, nachhaltigen Blick.
Uns interessiert das Naheliegende
Die ersten Hefte waren thematisch sehr vielfältig – gibt es ein redaktionelles Konzept oder seid Ihr offen und dankbar für alles, was Euch angeboten wird?
FB: In den ersten Ausgaben waren wir notgedrungen sehr offen. Uns fehlte es an Zeit und Mitteln, um wie eine echte Redaktion zu arbeiten. Das ändert sich nun. Wir definieren unsere Position: Uns interessiert das Nahe, Unmittelbare. Uns interessieren Reportagen aus der Umgebung, allenfalls die Auswirkung globaler Themen auf unseren Alltag. So grenzen wir uns ab von anderen Reportage-Magazinen, wie etwa dem sehr erfolgreichen XXI, das ebenfalls regelmässig Comic-Reportagen abdruckt und der klassischen Reportage aus fernen Gefilden huldigt. Wir behalten uns allerdings vor, von unserem Konzept abzuweichen, wann immer es sich aufdrängt.
Findet Ihr die Zeichnung für diese Art von Reportage besonders geeignet?
FB: Mit der Zeichnung ist heute so gut wie alles möglich, und ich würde nie ein Thema mit der Begründung ablehnen, es sei für den Comic ungeeignet. Die Sprache der Comics ist sehr hoch entwickelt, und die Autoren setzen sie inhaltlich und zeichnerisch auf sehr unterschiedliche Weisen um. Eigentlich haben wir nur ein Dogma: Nichts verhindern, möglichst viel ausprobieren. Natürlich ist nicht jede Reportage in den ersten Heften gleichermassen gelungen, aber auch gescheiterte Versuche bringen uns weiter. La Revue Dessinée versteht sich ausdrücklich auch als Labor.
Treten Journalisten und Zeichner mit Themenvorschlägen an Euch heran oder erteilt Ihr auch Aufträge?
FB: In den Anfängen waren wir wie gesagt dankbar für Vorschläge. Nun aber lancieren wir mehr und mehr Projekte, grosse Themen, die uns während mehreren Ausgaben begleiten sollen. Ein Thema ist die Erstarkung des Nationalismus in vielen europäischen Ländern. Da arbeiten wir mit Korrespondenten zusammen. Andere Schwerpunkte sind die erneuerbaren Energien und die Entwicklungen im urbanen Raum.
Die «Wahrheit» einfangen
Comic-Zeichner sind nicht automatisch auch Journalisten. Wie gewährleistet Ihr die Qualitätsansprüche und die Ethik des Journalismus?
FB: Für uns war wichtig, dass von allem Anfang an ein erfahrener Journalist und Redaktor in unserem Team war. Heute haben wir zwei Vorgehensweisen. Entweder versteht sich ein Comic-Autor auch als Journalist, recherchiert selber vor Ort und setzt seine Reportage selbständig um. Unlängst entstand so die erste Reportage zu einer Kaderschulung des Front National. Oder es tritt ein Journalist mit einem Thema an uns heran, wir besprechen es und schlagen geeignete Zeichner vor. Dann liegt es am Journalisten und am Zeichner, sich zusammenzuraufen. In diesem Fall liegt die Schwierigkeit darin, dass der Zeichner nicht vor Ort recherchiert hat. Deshalb ermutigen wir die Zeichner, den journalistischen Stoff zeichnerisch zu interpretieren und nicht eine falsche Authentizität vorzugaukeln. Wichtig ist dabei aber, dass die Umsetzung ehrlich ist und die «Wahrheit» einzufangen versucht.
Im Editorial der ersten Nummer habt Ihr Euch in die Tradition der grossen graphischen Zeitungen des 19. Jahrhunderts gestellt; Zeitungen wie Le Journal illustré, The Graphic, Le Petit Journal. Seht Ihr Euch tatsächlich in dieser Tradition?
FB: Ja, wenn auch auf eine sehr bescheidene Weise. Im 19. Jahrhundert war die Zeichnung viel wichtiger als heute, weil die Fotografie noch keine echte Konkurrenz darstellte. Damals gab‘s aber noch keine Comic-Reportagen im heutigen Sinn; es handelte sich um Illustrationen, Zeichnungen, Bildstrecken. Eine andere Tradition, die für uns wichtig ist, sind die Comic-Reportagen, die in den Sechziger- und Siebzigerjahren in Satire-Zeitschriften wie Hara-Kiri und Charlie Hebdo erschienen sind.
Das Foto ist extrem Banal geworden
Wie erklärst Du Dir das Comeback der Zeichnung zum Einfangen der Realität? Im 20. Jahrhundert war das ja weitgehend die Domäne der Fotografie.
FB: Wegen der vielen Wiederholungen und ihrer Allgegenwart wirkt die Fotografie heute verbraucht. Jeder ist heute ein Fotograf, aber nicht jeder ist ein Zeichner. Die Zeichnung bringt einen individuellen Blick auf einen Ort oder ein Ereignis zum Ausdruck, den Blick eines Autors. Das macht sie interessant. Dazu kommt die Komplexität des Comics: Er erzählt auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Bis zu einem gewissen Punkt ist dieses neue Interesse an der Zeichnung auch ein Modephänomen. Die Krise der Presse sitzt dermassen tief, dass sich Redaktionen und Verlage an jedem Strohhalm festklammern. Einer dieser Strohhalme ist die Zeichnung. Eine Zeichnung ist immer hübsch und überraschend, und sie wirkt frisch und unverbraucht. Deswegen greifen Zeitschriften und Zeitungen heute gerne auf Zeichnungen zum Bebildern ihrer Artikel zurück. Ich befürchte allerdings, dass die Zeichnung die klassische Presse nicht aus ihrer Krise erlösen wird – das ist ein kosmetischer Eingriff, doch die Presse benötigt einen viel tiefer greifenden Eingriff, um sich neu zu erfinden.
Wo siehst Du die hauptsächlichen Unterschiede zwischen Zeichnung und Fotografie?
FB: Durch die Allgegenwart der Fotokamera in unseren Mobiltelefonen ist das Foto extrem banal geworden. Früher galt die Fotografie als treues Abbild der Wirklichkeit – heute sind wir medienkompetent genug, um einer Fotografie nicht einfach zu trauen. Sie ist nicht unbedingt authentisch. Die Zeichnung ist eine weniger brutale und direkte Vereinnahmung der Realität. Der Zeichner verarbeitet die Realität, er muss sie verinnerlichen und neu erschaffen. Dafür muss er sich Zeit nehmen. Das spüren die Leserinnen und Leser – und das spricht sie an.
Hast Du Angst davor, dass das Interesse an der gezeichneten Reportage abflaut?
FB: Es liegt an uns, Geschichten zu zeichnen, die das Interesse der Leserschaft längerfristig fesseln. Das sage ich nicht in erster Linie als Herausgeber einer Zeitschrift, sondern auch als Leser: Ich halte die gezeichnete Reportage tatsächlich für sehr wichtig, weil sie einen anderen Blick auf die Aktualität erlaubt. Die Comic-Reportage nimmt sich Zeit. Die Langsamkeit ihrer Entstehung ist im besten Fall ein Vorteil: Zeit ermöglicht Distanz zum Ereignis, sie ermöglicht auch Reflexion. Das gibt die Comic-Reportage an den Leser weiter: Sie gibt ihm Zeit und Raum, sich in ein Thema zu vertiefen. Diese Langsamkeit ist heute, wo sich die Informationshäppchen jagen und gegenseitig aufheben, besonders wichtig. Vielleicht klinge ich altväterisch und konservativ, aber das ist mir egal. Ich bin überzeugt, dass wir immer aufmerksam sein sollen, um die wesentlichen Ereignisse aufzugreifen und zu verstehen. Andererseits sollten wir uns dabei nie beeilen oder hetzen lassen.
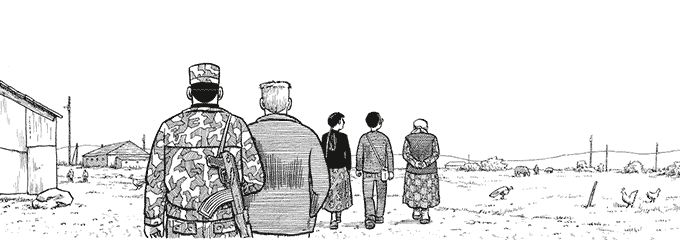
JOE SACCO
Von der Autobiographie zur Reportage
Ohne Joe Sacco würde die Comic-Reportage heute vermutlich noch immer ein Nischendasein fristen.
Mit seinen mehrere hundert Seiten starken Reportagen «Palästina», «Bosnien» und «Gaza» sorgte der 1960 auf Malta geborene Joe Sacco weit über die Comic-Szene hinaus für Furore. Sein Erfolg war jedoch alles andere als selbstverständlich, wie ein Blick auf seine Anfänge zeigt.
Oft wird vergessen, dass Joe Sacco seine Laufbahn mittels Yahoo begann. Zwischen 1988 und 1992 ver-
öffentlichte er in sechs Yahoo-Heften überdreht-witzige, autobiographische Geschichten. Schon früh schlug Saccos Neigung zum Journalismus durch; die Autobiographie mutierte zur Reportage aus dem eigenen Leben. Am deutlichsten wurde dies, wenn er die Europatournee der amerikanischen Rockband The Miracle Workers schilderte, seine Mutter über die Bombardierung Maltas während des Zweiten Weltkriegs ausfragte oder sich selber als einen vom Ersten Irakkrieg ebenso faszinierten wie traumatisierten «War Junkie» inszenierte. Die Folge: 1991 beschloss Sacco, seine Leidenschaften Comics und Journalismus zu verknüpfen. Er quittierte seinen Job als Redaktor einer Zeitschrift für Notare und reiste in den Nahen Osten, wo er Hunderte von Palästinensern über ihr Leben während der Ersten Intifada ausfragte.
Diese erste Reportage machte auch Saccos journalistisches Credo sichtbar: Er verzichtete ausdrücklich auf Neutralität und Ausgewogenheit. In «Palästina» wollte er den Palästinensern Gehör verschaffen, weil die amerikanischen Medien weitgehend die israelische Version des Konflikts vermittelten und die Palästinenser als Opfer oder Terroristen darstellten. «Ich glaube nicht an die Objektivität, wie sie in amerikanischen Journalismus-Schulen gelehrt wird», so ein oft zitierter Ausspruch Saccos, «ich glaube an die Fairness. Natürlich vermittle ich in erster Linie eine palästinensische Perspektive, aber das heisst nicht, dass ich Partei ergreife oder die Rolle der Palästinenser beschönige. Ehrlichkeit ist das Wichtigste.» Diese Anwaltschaftlichkeit steht, da sie offen deklariert wird, nicht im Widerspruch zu Saccos hohen journalistischen Ansprüchen.
Abgebrannt und einsam
«Palestine», Joe Saccos erste grosse Reportage, erschien zunächst zwischen 1993 und 1995 in neun Comic-Heften – und mauserte sich zu einem der grössten Flops für den unabhängigen Verlag Fantagraphics Books. Eher unmotiviert bündelte Fantagraphics die Hefte 1996 zu einer zweibändigen Buchausgabe – plötzlich regte sich Interesse an dieser Reportage, und Joe Sacco wurde mit einem American Book Award ausgezeichnet.
Joe Sacco hatte jedoch nicht auf diesen Preis gewartet um seine zweite grosse Reportage in Angriff zu nehmen: Er reiste Ende 1995 für ein paar Monate nach Bosnien. Das erste von drei Büchern über den Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien, «Bosnien», entstand zwischen 1996 und 2000. Diesmal verzichteten Verlag und Autor auf den Vorabdruck in Heftform. Das brachte Sacco eine mehr-
jährige Durststrecke ein, da er vier Jahre lang so gut wie kein Einkommen hatte. In den Neunzigerjahren war er, erinnerte er sich in einem Gespräch, «ständig pleite, ich vereinsamte und hatte jahrelang keine Freundin, weil niemand mit einem notorisch abgebrannten Typen ausgehen mag. Davon hatte ich genug.» Nach «Bosnien» wollte er den Comic-Journalismus an den Nagel hängen, eine Rezension in der New York Times brachte jedoch den Wendepunkt. Heute sind «Palästina» und «Bosnien» Bestseller, in viele Sprachen übersetzt, vielfach ausgezeichnet, immer wieder neu aufgelegt und weit über die Comic-Szene hinaus wahrgenommen worden.
Hartnäckige Recherchen
Joe Sacco hat die Comic-Reportage nicht erfunden, aber er hat ein verschlafenes Genre in mehrfacher Hinsicht neu definiert: Er verliess die kurze Form und legte mit «Palästina», «Bosnien» oder «Gaza» mehrere hundert Seiten starke Reportagen vor. Statt in seiner Umgebung zu recherchieren, reiste er an geopolitische Brennpunkte unserer Zeit. Im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen hat Joe Sacco Journalismus studiert und betreibt seinen Beruf sehr gewissenhaft. Während nicht wenige Comic-Journalisten, zugespitzt formuliert, bereits ihr Reise-Skizzenbuch mit einer Reportage verwechseln, arbeitet Sacco mit hohen journalistischen Ansprüchen.
Er recherchiert gründlich und hartnäckig, legt seine Quellen offen und gleicht widersprüchliche Aussagen ab. Damit sind seine Geschichten, vor allem «The Fixer» und «Gaza», auch eine Reflexion des Potenzials und der Grenzen der Comic-Reportage.
Seit dem Erfolg von «Palästina» und «Bosnien» sucht Sacco im Auftrag namhafter Zeitschriften und Verlage auch andere Kriegs- und Krisengebiete auf: Den Kau-kasus, Afrika, Indien, die nordamerikanischen Minengebiete in den Appalachen oder auch seine Heimat Malta, deren fragwürdiger Umgang mit afrikanischen Flüchtlingen er untersuchte. Diese kürzeren Geschichten erschienen gesammelt im Band «Reportagen».
Die Verknüpfung von Journalismus und Comics, das soll dieser Rückblick auf Saccos Anfänge verdeutlichen, war alles andere als ein kommerzielles Kalkül. Ohne seine Überzeugung und Leidenschaft würde die Comic-Reportage wohl noch immer ein Nischendasein fristen. Wenn heute nicht-fiktionale Comics zu zeitgeschichtlich brisanten Themen boomen und niemand mehr dem Comic die Fähigkeit abspricht, auch komplexe Themen adäquat zu verarbeiten, liegt das nicht zuletzt auch an Joe Saccos Reportagen.
Veröffentlichungen auf Deutsch:
Joe Sacco: «Bosnien». Edition Moderne
234 S., s/w, Klappenbroschur, Euro 28 / sFr. 39.80
Joe Sacco: «Palästina». Edition Moderne
288 S., s/w, Klappenbroschur, Euro 29.80 / sFr. 42.-
Joe Sacco: «Gaza». Edition Moderne
432 S., s /w, Klappenbroschur, Euro 35 / sFr. 48.-
Joe Sacco: «Reportagen». Edition Moderne
92 S., s /w, Klappenbroschur, Euro 28 / sFr. 39.80
Joe Sacco: «Der Erste Weltkrieg. Die Schlacht an der Somme». Edition Moderne, Leporello
24 S., s/w, im Schuber, Euro 35 / sFr. 49.-
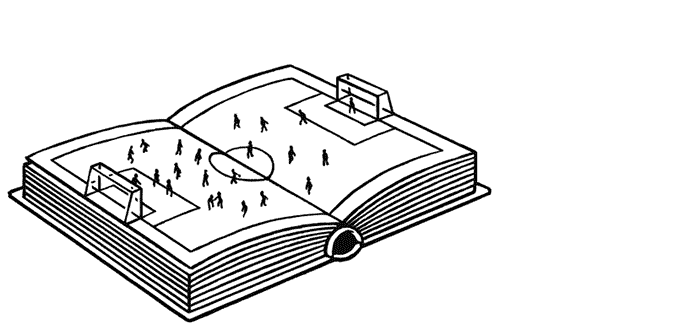
DAS GESCHRIEBENE WORT
Die Breite an der Spitze ist dichter geworden
Wenn in der STRAPAZIN-Redaktion schon niemand auf die Idee kommt, endlich einmal ein Heft mit dem Thema Fussball zu machen, dann muss der feinsinnige Poet vom Geschriebenen Wort diesbezüglich die Stutzen hochziehen und den Ball aufpumpen.
Wie immer in den Jahren mit einer Weltmeisterschaft knüppeln heuer die Verlage eine erhöhte Anzahl Fussballbücher in die Landschaft, thematisch umfassend, von der wirtschaftlichen oder kriminalistischen Analyse des Geschäfts mit dem Fussball bis hin zu trunken sentimentalen Geständnissen und Erinnerungen.
Beliebt sind auch immer wieder Sammlungen der oft sehr sinnfreien oder dadaistischen Sprüche des fussballerischen Personals. Der Titel dieses Geschriebenen Worts, die dichtere Breite, ist beispielsweise von Berti Vogts, einst gnadenloser Verteidiger, nunmehr Trainer auf dem Karriereabstieg.
Wenn einem Verlag gar nichts einfällt, lässt er, wie das Schweizer Fernsehen, einfach irgendeinen sogenannten Experten losschwallen und Anekdoten klopfen.
Wir wollen hier diesem losen Treiben enge Grenzen setzen. Und zwar mit der Erkenntnis des legendären Managers des FC Liverpool, Bill Shankly (1913 – 1981):
Es gibt Leute, die denken Fussball ist eine Frage von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich kann ihnen versichern, dass es noch sehr viel ernster ist.
Shankly sah im Fussball nicht nur eine sportliche, sondern auch eine kulturelle und politische Angelegenheit. Deshalb waren für ihn die Anhänger so wichtig wie die Spieler. Der bekennende Sozialist sah in seiner Auffassung des Fussballsports sein politisches Ideal verkörpert.
Ich bin ein Mann des Volkes – nur das Volk zählt. Im Sozialismus, an den ich glaube, arbeitet jeder für den anderen und alle bekommen einen Teil des Gewinns. So sehe ich Fussball, so sehe ich das Leben.
Der gute Mann konnte damals ja noch nicht ahnen, wie viel Geld man eines Tages mit Fussball verdienen würde.
Zu den linken Bewunderern des Fussballs gehört auch der Schriftsteller und Journalist Eduardo Galeano, geboren 1940 in Montevideo/Uruguay. Bekannt geworden ist er durch sein Werk «Die offenen Adern Lateinamerikas», eine Geschichte der wirtschaftlichen Ausbeutung des Kontinents durch die Kolonialherren und die USA. Seine Sammlung von Fussball-Essays «El futbol a sol y sombra», deutsch «Der Ball ist rund», ist eine Geschichte des südamerikanischen Fussballs und aller Weltmeisterschaften. Es gibt jetzt eine aktualisierte Neuausgabe bis und mit 2010. Und seit 1962, anlässlich der WM in Chile, kann Galeano in seinem kurzen politischen Abriss des betreffenden WM-Jahres immer wieder den folgenden Satz anbringen:
Gewöhnlich gut unterrichtete Kreise in Miami prophezeiten den kurz bevorstehenden Sturz Fidel Castros, der nur noch eine Frage von Stunden sei.
Galeano ist aber vor allem ein Hymniker. Er erzählt unglaubliche Geschehnisse, Fussballwunder, Ballzauber und Mirakel des grünen Rasens, aber man glaubt ihm gerne jedes Wort. Er besingt in seinen wunderbaren Texten die grossen und die tragischen Helden des runden Leders, oft sehr poetisch, manchmal ironisch, aber immer sehr wahrhaftig.
Fussball ist unser Leben, denn König Fussball regiert die Welt!
Das sang die deutsche Nationalelf zur WM 1974. Wahre Worte, prophetische Worte. Franz Beckenbauer hatte ja schon 1967 kurz Karriere als Schlagersänger gemacht, etwa mit dem schrecklichen Gassenhauer «Gute Freunde».
Im Rahmen dieser WM in Deutschland änderte sich der Fussball grundlegend. Das ist die Hauptthese des Buchs von Kay Schiller «WM 74. Als der Fussball modern wurde». Also Geschäft statt Ehre, Fernsehübertragung statt Randdasein, Spektakel statt Romantik, aber auch der totale Fussball – etwa der Holländer – gegenüber den altertümlichen Defensivkonzepten. Beckenbauer selber drückte es so aus, dass er lieber für eine Siegesprämie in der Nationalmannschaft spielen würde als der Ehre wegen. Ja, da wurde noch aufgeheult! Die Kapitalisierung des Fussballs begann im Juni 1974, kurz vor der WM, mit dem Wechsel an der FIFA-Spitze von Sir Stanley Rous zum brasilianischen Waffenhändler Joao Havelange als Präsidenten und vom prinzipienfesten Schweizer Helmut Käser hin zum eher windigen Walliser Joseph Blatter als Generalsekretär (ja, seit vierzig Jahren ist der schon dabei und verteilt braune Umschläge voll Bargeld).
Der Autor des sehr fundierten und quellenreichen Buches geht auch auf das fussballerische Verhältnis zwischen BRD und DDR ein, was insofern interessant ist, da ein Gutteil der Korruption in den Fussballverbänden später durch Stasi-Spione und ihre Berichte, die ja alle öffentlich einsehbar waren, aufgedeckt wurde.
Wer noch Näheres über das unappetitliche Wirtschaften der FIFA bzw. die Machtübernahme durch Havelange
und Blatter lesen will, der sei auf die Neuauflage des Standardwerks «FIFA Mafia. Die schmutzigen Geschäfte mit dem Weltfussball» des deutschen Journalisten Thomas Kistner hingewiesen. Hier wird auch noch ein weiterer Grossmeister der Korruption eingeführt, der Herr über Adidas, Horst Dassler, neben Havelange und Blatter der eigentliche Pate.
Kommen wir wieder zum schönen Spiel zurück, zu Literatur und Fussball.
Hier rollt ein runder Ball in dem bestimmten Gleisse Nach dem erwählten Zweck mit langen Sätzen fort.
Das vermeldet schon Albrecht von Haller in seinem Epos «Die Alpen» von 1729. Der Universalgelehrte Haller, 1708 in Bern geboren und 1777 ebendort gestorben, war selbstverständlich Anhänger der Young Boys, die es, so wie heute, auch im 18. Jahrhundert nicht einfach hatten mit dem runden Leder.
Haller ist allerdings nicht dabei in einer sehr netten Anthologie mit dem Titel «Ein Leben ohne Fussball ist möglich, aber sinnlos». Da sind Fussball-Satiren von Ringelnatz, Ror Wolf, Gernhardt, Henscheid, Trapattoni bis hin zu heutigen Jubelpersern wie Moritz Rinke versammelt. Da ist viel Kohlenpott-Romantik drin, vor allem von den neueren Autoren, so als ob sie in der gnadenlosen neuen Fussball-Finanzwelt immer noch ein bisschen Romantik suchen würden. Auch in diesem Buch ist die mehr oder weniger offizielle Hymne der DDR für die WM 1974 abgedruckt. Diese wurde nicht von der Mannschaft, sondern von Frank Schöbel gesungen, ist nicht so militärisch und hat das knackigere Riff und den besseren Text als «Fussball ist unser Leben».
Ja, der Fussball ist rund wie die Welt
Überall rollt der Ball
Und wenn einer zum anderen hält
Trifft der Ball, klarer Fall
Das literarische Genre, das sich noch am meisten mit Fussball beschäftigt, ist der Krimi. Beste Beispiele sind «Ab-
blocken» von Dan Kavanagh alias Julian Barnes, «Schuss aus dem Hinterhalt» von Manuel Vasquez Montalban oder «Knochenmann» von Wolf Haas. Die Nähe des Fussballs zu halbseidenen und kriminellen Umfeldern ist auch im Krimi «Kölner Grätsche» von Stefan Keller das Thema. Ein brasilianischer Starspieler muss nach einer Verletzung seine Karriere beenden und gerät wegen riesiger Wettschulden in Probleme. Als seine Freundin entführt wird, hilft ihm ein Privatdetektiv, der eigentlich auf gestohlene Kunstwerke spezialisiert ist. Der entdeckt in Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad, einen Zusammenhang zwischen Fussball, Wettmafia, Kunstraub und Geldwäscherei und kommt dabei ziemlich in die Bredouille. Ein gut konstruierter und spannender Krimi, den selbstverständlich auch Nicht-Fussball-Interessierte lesen können.
Zum Schluss noch der Fussballerspruch des Jahres, den
die «Deutsche Akademie für Fussball-Kultur» 2013 ausgezeichnet hat: Links ist ähnlich wie rechts, nur auf der anderen Seite. Wahre und weise Worte des Spielers Patrick Funk, der beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht.
BOOKLIST:
Eduardo Galeano: «Der Ball ist rund». Unionsverlag
290 S., Hardcover, Euro 14.99 / sFr. 22.90
Kay Schiller: «WM 74. Als der Fussball modern wurde».
Rotbuch Verlag, 192 S., Softcover, Euro 14.95 / sFr. 21.90
Gerhard Richter (Hg.): «Ein Leben ohne Fussball ist möglich, aber sinnlos. Die besten Fussball-Satiren». Verlag Ellert & Richter, 192 S., Hardcover, Euro 14.99 / sFr. 19.90
Thomas Kistner: «FIFA Mafia. Die schmutzigen Geschäfte mit dem Weltfussball». Droemer/Knaur
464 S., Softcover, Euro 12.99 / sFr. 19.40
Stefan Keller: «Kölner Grätsche». Gmeiner Verlag
275 S., Softcover, Euro 11.99 / sFr. 17.90

DAS MAGAZIN
Simon Schwartz: Vita Obscura
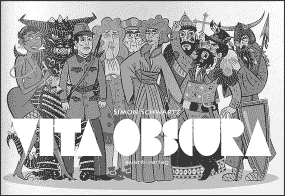
Von Käuzen und Sonderlingen
Vergessene, obskure und übersehene Lebensgeschichten scheinen Simon Schwartz nicht mehr loszulassen. Nach «Packeis» über Matthew Hanson, den ersten Menschen am Nordpol, der aufgrund der falschen Hautfarbe – er war Afroamerikaner – in der Geschichtsschreibung ignoriert wird, versammelt sein aktuelles Projekt «Vita Obscura» eine ganze Reihe solcher fast vergessener Biographien: den «Kaiser von Amerika», Musiker wie Moondog oder Robert Johnson, untergetauchte Könige, siamesische Zwillingsentertainer… Die jeweils einseitigen Comics, die ursprünglich als Stripfolge in der Wochenzeitung Freitag erschienen sind, beschränken sich jedoch nicht bloss auf die Präsentation möglichst obskurer Lebensläufe: Die Personen erhalten liebevolle Würdigungen, von humorvollen Hommagen an tragisch-komische Figuren wie Hetty Green, die wohl geizigste Frau aller Zeiten, bis hin zu dem traurigen Schicksal eines Mannes wie Witold Pilecki, der aus Auschwitz floh und im Warschauer Ghettoaufstand kämpfte, nur um 1948 in einem Schauprozess aufgrund des Verdachts auf Spionage für den Westen von den Sowjets hingerichtet zu werden. Diese Beispiele zeigen auch die Breite der Auswahl, die Schwartz vorgenommen hat, eine Vielfalt, die sich ebenso im Stil niederschlägt: Jeder Biographie hat Schwartz eine eigene Ästhetik gewidmet. Die acht bizarrsten Todesursachen burmesischer Herrscher gibt es als Sammelkarten, der Flugzeugentführer D.B. Cooper wird als Sicherheitshinweis im Flugzeug präsentiert, Sarah Winchesters tragisches Schicksal spiegelt sich in einer Hausarchitektur, in der jedes Zimmer zu einem Panel wird, und Ken Keseys Drogentrip besticht durch psychedelische Farbkleckse. Virtuos spielt Schwartz mit Stilen und Formen, mit Farben und Ideen, collagiert Urlaubsimpressionen, modelliert Reliefs und baut Schattenspiele, die er danach abfotografiert. Dass er diese Freiheit gewährt bekommt – darauf verweist auch Andreas Platthaus in seinem Vorwort – ist keine Selbstverständlichkeit, wohl kaum ein anderes Format in der Welt des Comics ist strikteren Vorgaben ausgesetzt, wie der bunte wöchentliche Strip. Diese haben in der Regel aus drei Panelreihen zu bestehen, deren erste keinen Bezug zur eigentlichen Geschichte haben darf, damit die Zeitung sie, etwa im Falle einer Werbeanzeige, für die der Platz benötigt wird, wegkürzen kann. Dass Schwartz sich nicht an solche Zwänge halten musste, ist ein Glücksfall und so wird «Vita Obscura» nicht nur zu einer Hommage an die vor dem Vergessen bewahrten Personen, die darin porträtiert sind, sondern darüber hinaus auch zu einer Hommage an die Möglichkeiten des Zeitungscomics oder gar an die ästhetischen Möglichkeiten des Mediums Comic insgesamt.
Jonas Engelmann
Simon Schwartz: «Vita Obscura». avant-verlag
72 S., Hardcover, farbig, Euro 19.95 / sFr. 29.90
Stephen Collins: Der gigantische Bart, der böse war
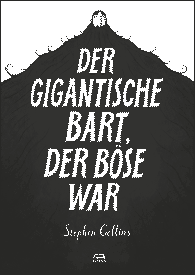
Parabel auf das Haar in der Suppe
Der Engländer Stephen Collins ist ein erfahrener Cartoonist und führt eine feine Feder. Die Technik des Cartoons beherrscht er bis zur Perfektion und er weiss genau, wie man mit Bildern erzählt: Jeder Strich sitzt, keiner ist zu viel. Die Panels setzt er – bis ins Detail wohldurchdacht – auf jede Seite und richtet sie ganz auf die erzählerische Wirkung aus. Wo, aufs Ganze betrachtet, die Seiten streng geordnet erscheinen, da gewinnt Colins seine Leser durch die Vielfalt und Variation seiner Layouts. So finden sich eng verschachtelte oder wild zersplitterte Panel-Kombinationen neben doppelseitigen Panoramen oder einer Seite, die auf eine einzige und winzige Sprechblase reduziert ist.
In der präzise abgestimmten Art und Weise, wie Form und Inhalt, Realität und Absurdität zusammenspielen, erinnert Collins’ Graphic Novel «Der gigantische Bart, der böse war» an Marc-Antoine Mathieus Serie um Julius Corentin Acquefacques, den Gefangenen der Träume. Allerdings ist Collins’ Welt weniger düster und verwinkelt als jene von Mathieu: Artige Menschen mit putzigen Gesichtern und sympathischen Kugelaugen bevölkern die durch und durch wohlgeordnete Insel «Hier». «Hier» steht für die Ordnung schlechthin. Alles ist aufgeräumt und geregelt. Jeder Baum und jede Strasse sind perfekt. Die Menschen haben einen festen Platz. Die Arbeit bietet Sicherheit, das Zuhause Erholung. Diese Ordnung behagt auch Dave, der im Industriezen-trum von «Hier» Daten zu Präsentationen aufbereitet. Er mag die Ordnung der Zahlen und Statistiken. Sie verdrängen die Gedanken an die Unordnung, welche die Bewohner von «Hier» mit «Dort» verbinden. «Dort» ist das Unbekannte, das Land jenseits des Meeres. «Dort» löst bei den Menschen in «Hier» gut verborgene Ängste aus.
Unter Daves Haut aber regt sich etwas, das sich nicht bändigen lässt: Zunächst ist es nur ein einziges, widerspenstiges Schnauzhaar, dann plötzlich beginnt Daves Bart zu wachsen – und er wächst und wächst und hört nicht mehr auf zu wachsen. Bald sind alle Friseure der Insel damit beschäftigt, seinen Bart zu zähmen, und die Bart-Krise bricht aus – da sich die Leute ihre Haare selber schneiden müssen, was die gepflegte Ordnung nicht vorsah.
Von da weg rollt die Geschichte unerbittlich und mit dem Biss der Satire einem Ende zu, das für Dave nicht gut kommen kann, wobei Collins die Geschichte keinem ordentlichen Finale zuführt, sondern den Ausgang der Fantasie überlässt. Ob seine Graphic Novel wirklich, wie auf dem Klappendeckel behauptet, das Zeug zum Klassiker hat, wird sich weisen, auf jeden Fall liest sich «Der gigantische Bart, der böse war» spannend und lässt sich mit Musse betrachten – was will man mehr von einem Bilderroman?
Florian Meyer
Stephen Collins: «Der gigantische Bart, der böse war».
Atrium Verlag, 240 S., Hardcover, s/w,
Euro 29.99 / sFr. 38.90
Willem: Traquenards et mélodrames / Billy the Kid

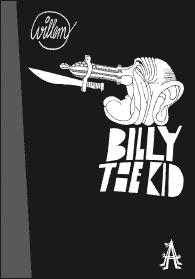
Albträume aus einer dysfunktionalen Gesellschaft
Als Willem 2013 mit dem Grossen Preis der Stadt Angoulême für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, gingen die Wogen hoch. Ein Karikaturist sei er, kein Comic-Zeichner, monierten viele, und deshalb sei der Preis unverdient. Tatsächlich ist der Holländer mit der schlohweissen Haarmähne und dem immer leicht verdutzt wirkenden Gesichtsausdruck eines Heranwachsenden heute vor allem als zeichnender Kommentator des politischen Geschehens in der linken Tageszeitung Libération beliebt und gefürchtet – vergessen ging in dieser Polemik jedoch, dass Willem bis 1985 auch Comics zeichnete. Der dicke Band «Traquenards et mélodrames» (Fallen und Melodramen) versammelt nun die besten Seiten, die Willem von 1968, dem Jahr seiner Ankunft in Paris, bis 1985 für Satirezeitschriften wie Hara-Kiri und Charlie Hebdo zeichnete. Der Anarchist führte seine Feder mal wie ein Skalpell, mal wie einen Zweihänder und zuweilen auch wie einen Flammenwerfer, um Gesellschaft, Politik, Kapitalismus, Kirche, Feminismus, Neokolonialismus, Spiessbürgertum, aber auch die linke Gegenkultur zu demontieren und mit seinem Hang zum Absurden ins Chaos zu reissen. Wie in seinen Karikaturen war Willem auch in seinen Comics durchaus parteiisch, allerdings unideologisch, rücksichtslos, jedoch höflich, erfrischend boshaft und immer wieder überraschend. Die Lektüre von «Traquenards et mélodrames» ist doppelt aufschlussreich: Zum einen führt sie zurück in die Befindlichkeiten und Auseinandersetzungen einer weit entfernt scheinenden Vergangenheit. Andererseits ist es bestürzend festzustellen, wie aktuell Willems satirische Albträume aus einer dysfunktionalen Gesellschaft geblieben sind. Die Probleme sind ähnlich, Lösungen sind nach wie vor keine in Sicht – dafür gibt es heute weniger Illusionen und Ideale als damals. Neben «Traquenards et mélodrames» wurde auch Willems allererster Comic «Billy the Kid» (1968) wiederveröffentlicht, eine irrwitzige Satire des amerikanischen Imperialismus. Die USA haben China den Krieg erklärt, und Billy the Kid macht Karriere in der US-Army, die eine tiefe Schneise der kulturellen Verwüstung durch China reisst – angeführt werden die amerikanischen Truppen von einem von Sklaven gezogenen Wagen, in welchem die Freiheit, die Justiz und die heilige Jungfrau sich im Dienste des amerikanischen Imperialismus prostituieren. Obschon «Billy the Kid» vom Geist der späten Sechzigerjahre durchtränkt ist, entpuppt sich die Story als durchgeknallt genug, um auch heute zu funktionieren.
Es ist wirklich schade, dass das voluminöse Werk Willems als Comic-Zeichner und Karikaturist im deutschen Sprachraum bloss in winzigen Bruchstücken – und das auch nur dank ein paar längst vergriffenen Büchern der Edition Moderne – bekannt ist, und dass man, um «Traquenards et mélodrames» und «Billy the Kid» zu lesen, zum Wörterbuch greifen muss. Der Effort lohnt sich auf jeden Fall.
Christian Gasser
Willem: «Traquenards et mélodrames». Cornélius
240 S., Softcover, s/w und farbig, Euro 29.50 / ca. sFr. 40.–
Willem: «Billy the Kid». Apocalypse
88 S., Softcover, s/w, Euro 17 / ca. sFr. 26.–
Fanny Britt & Isabelle Arsenault: Jane, der Fuchs & ich
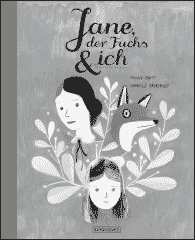
Zurückweisung und Rückzug
Hélène durchlebt in der Schule täglich den Horror: Heute würde man das neudeutsch Mobbing nennen, was ihre Mitschüler dem angehenden Teenager antun. Von ihren ehemaligen Freundinnen wird sie nicht nur gemieden, sondern regelrecht schikaniert. Diffamierende Klosprüche und verbale Bosheiten sind an der Tagesordnung: Angeblich sei sie zu dick und würde stinken. Hélène flüchtet sich in die Literatur. Mit Begeisterung und Anteilnahme verfolgt sie das Schicksal von Jane Eyre aus dem gleichnamigen Buch von Charlotte Brontë. Sie bewundert die Stärke und das Selbstbewusstsein von Brontës Heldin und zieht Parallelen zu ihrem Schicksal. Als es auf eine Klassenfahrt geht, spitzen sich die Ereignisse zu. Kann Hélène ihre literarische Deckung da noch weiterhelfen?
«Jane, der Fuchs & ich» ist das Comic-Debüt der kanadischen Autorin Fanny Britt, für das sie mit dem Shuster-Award ausgezeichnet wurde. Zusammengearbeitet hat sie mit der bereits mehrfach ausgezeichneten Kinder- und Jugendbuchillustratorin Isabelle Arsenault. Für «Jane, der Fuchs & ich» erhielt Arsenault bereits zum dritten Mal den Prix du Gouverneur, den renommiertesten kanadischen Literaturpreis. Ausserdem wurde «Jane, der Fuchs & ich» von der New York Times unter die zehn bestillustrierten Bücher 2013 gewählt. Zu grossen Teilen ist die viel prämierte Geschichte in schwarzweissen Bleistiftzeichnungen gehalten. Durch ihren skizzenhaften, ein wenig schmutzig wirkenden Stil verstärken die Zeichnungen den düsteren Grundton der Geschichte. Der permanent gesenkte Kopf der jungen Protagonistin mit ihren hängenden Schultern steht in starkem Kontrast zu den dynamischen Klassenkameraden, die feixend um sie herumstehen. Die gemeinen Sprüche hat Hélène längst antizipiert, obwohl sie nicht im Geringsten zu Übergewicht neigt. Das ist die grausame Macht des Mobbings – schon im Kindesalter: Irgendwann glauben die Betroffenen, was man ihnen vorhält. Wie unter einer Glocke scheint Hélène durch die Welt zu laufen. Sogar die Bäume erscheinen wie Ungeheuer, drohend über ihrem Kopf. Wenn Hélène aber in die Welt der Literatur flüchtet, werden die Zeichnungen farbig und akkurat. Schliesslich gelingt es der jungen Protagonistin dann doch noch, aus diesem Teufelskreis von Zurückweisung und Rückzug auszubrechen, und alles gewinnt an Farbe.
Christian Meyer
Fanny Britt & Isabelle Arsenault: «Jane, der Fuchs & ich».
Reprodukt, 104 S., Hardcover, farbig,
Euro 29 / sFr. 40.90
Florent Ruppert & Jérôme Mulot: Un Cadeau
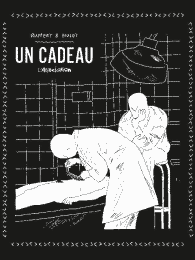
Ein Comic zum Auspacken
Ein Comic, bei dem sich die Autoren zuerst bei den Lesern dafür entschuldigen, dass man ihn nicht umblättern kann, sondern wie ein Paket auspacken muss, hat es irgendwie in sich. Tatsächlich enthält der Comic mit dem vielsagenden Titel «Un Cadeau» (dt. ein Geschenk) nur 16 Seiten. Diese sind nicht geheftet, sondern aneinander gepappt, übereinander gelegt und in einen dünnen Papiersockel zwischen den Buchdeckeln eingelassen. Wer der Erzählung folgen will, muss auf jeder Seite die Lasche suchen, die man aufreissen muss, um die nächste Seite lesen zu können. Dabei kommen alle Varianten zum Zuge: Mal gibt es Seiten, die sich waagrecht auseinandernehmen lassen, mal solche, die übers Kreuz aufgeklappt werden müssen, mal solche, die man in der Mitte von oben nach unten öffnet.
Hat man erst alle Klappen und Seiten geöffnet, fragt es sich, ob man sie überhaupt wieder schliessen oder lieber als Mini-Skulptur ins Bücherregal stellen will. Ein «livre-objet» nennen das die Franzosen: Das Buch als Lektüre und Kunstgegenstand.
Ruppert & Mulot sind zwei Autoren, welche die Potenziale des Comics ausloten und auf andere Medien übertragen: So haben die beiden einen Online-Comic zum Umblättern im Browser verfasst (www.professeurcyclope.fr/revues/arte/fr/#chapter/la_chaise ), eine illustrierte Kurzgeschichte im Opinionator, der Blog-Kollektion der New York Times, veröffentlicht, einen Comic auf Zeitungspapier gedruckt oder eine Plakatfläche in einer Pariser Metrostation gestaltet. Eine Projekt-Übersicht findet sich auf der Facebook-Seite des Duos.
Passend zu ihrer Verpackung, handelt auch die Geschichte «Un Cadeau» vom Auspacken. Eine Geschichte freilich, die Lesern mit dünnen Nerven und wenig Geduld nicht ans Herz zu legen ist: Schauplatz ist die Leichen-halle im Pariser Spital Saint-Louis. Dort obduzieren zwei Studenten eine Leiche. Mit jeder geöffneten Seite legen die beiden eine Schicht des Körpers frei. Am Ende der Obduktion überrascht der eine Student den anderen mit einem Geschenk – leider mit dem falschen. Etwas auf dem falschen Fuss erwischt, fühlt man sich auch als
Leser: Soll man nun schmunzeln oder die Stirn runzeln? Als Versuch und als Kunstwerk hingegen fügt sich
«Un Cadeau» gut in die Reihe experimenteller Comics ein, die mit formalen Zwängen spielen, und die bei L’Association Tradition haben. Irgendwie wähnt man sich, wenn man so Seite für Seite aufreisst, wie einst beim Öffnen des Weihnachtskalenders, und das ist auf seine Weise auch ein Geschenk.
Florian Meyer
Video, wie man «Un Cadeau» auspackt
Florent Ruppert & Jérôme Mulot: «Un Cadeau».
L’Association 16 S., Hardcover, s/w,
Euro 19 / sFr. 38.90
Michael Deforge: Ant Colony

Ameisen
Wenn sich einer der Protagonisten in «Ant Colony» anfangs die Frage stellt, warum in seinem Leben als Arbeiterameise alles so winzig und kleinlich sei, muss der Leser unverzüglich an die neurotische Ameise Z aus dem Animationsfilm «Antz» denken, der Woody Allen die Stimme leiht. Auch in Michael Deforges moderner Fabel werden existenzielle Themen durch anthropomorphe Ameisen aufgegriffen. Doch hier endet der Vergleich mit dem DreamWorks-Film bereits. Deforges Akteure, die mit dem Aussehen realer Ameisen wenig gemeinsam haben, entsprechen nicht den kindergerechten Figuren aus dem Film: ein schwules Liebespaar, das einander fremd geworden ist; ein Ameisen-Kind, das unter dem Nihilismus des Vaters leidet; ein feiger Ameisen-Polizist, der jeden Konflikt meidet. Als bei einer Schlacht gegen rote Ameisen beinahe die ganze Ameisenpopulation samt Königin ausgerottet wird, versuchen die Überle-benden in einer Szenerie, die an Becketts «Warten auf Godot» erinnert, mit Hilfe eines unfruchtbaren Weibchens eine neue Kolonie aufzubauen. Deforges grafische Studie über die fleissigen Insekten ist weder lustig noch verspricht sie einen freudigen Ausgang. Der 27-jährige Kanadier zeigt gerne das unappetitliche Innenleben von niedlichen Lebewesen und schreckt nicht vor triefenden Körpersäften und abgetrennten Gliedmassen zurück. Damit gehört Deforge – zusammen mit Johnny Ryan («Prison Pit») oder Dave Cooper («Ripple») – zu jenen Comic-Künstlern, die formales Design mit inhaltlich Ekligem vermengen. Dies tut der Autor mit minimalen Stilmitteln, zeichnerischer Eleganz und mit einer sicheren Hand für Farbkombinationen, die er aus seiner Arbeit als Plakat-Grafiker und Zeichentrickfilmer mitbringt. Comic-Kritiker sind erst seit kurzer Zeit auf ihn aufmerksam geworden, doch haben sie sofort ein grosses Talent in ihm erkannt. Nicht zu unrecht, denn Michael Deforge ist ohne Zweifel eine der originellsten Stimmen des zeitgenössischen amerikanischen Comics. Auch wenn sein Schaffen nicht jedermanns Geschmack ist.
Giovanni Peduto
Webseite des Autors: www.kingtrash.com
Michael Deforge: «Ant Colony». Drawn & Quarterly
112 S., Hardcover, farbig, englisch, $ 21.95
Eroyn Franklin: Making Tide and Other Stories / Another Glorious Day at the Nothing Factory
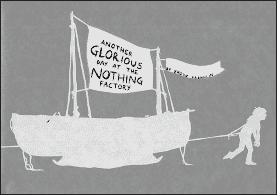
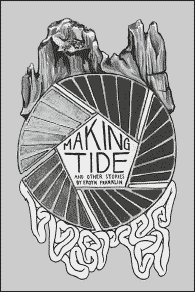
Fantastisches auf Papier - die Comics von Eroyn Franklin
Eroyn Franklin, in Seattle beheimatet, könnte man als Künstlerin bezeichnen, die sich von der Erzählform der Comics hat faszinieren lassen, ohne aber rein formalistische Werke zu schaffen – ihre Faszination bezüglich Struktur und Grammatik von Comics geht nicht so weit wie z.B. bei Art Spiegelman oder Marc-Antoine Mathieu. Ihre frisch und energiegeladen wirkenden Geschichten lesen sich vielmehr so, als sei sie gerade erst dabei, die Sprache der Comics zu erlernen. Nachdem ich in den letzten vier oder fünf Jahren die meisten ihrer Werke gelesen habe, scheint es mir, als sei sie noch immer dabei, das Potenzial des Mediums zu entdecken, während sie gleichzeitig nach neuen Möglichkeiten der Ausdrucksformen sucht.
Eroyn hatte bereits eine Neigung zum Konzeptuellen, als sie sich noch mit Fotografie und Zeichnung beschäftigte. Ihre Website www.eroynfranklin.com vermittelt Einsichten in ihre künstlerische Arbeit, die oft daraus besteht, die Umwelt zu zerlegen, auseinanderzunehmen – ob es um Raum und Zeit oder um Gefühle und Beziehungen geht. Sehr eindrucksvoll sind ihre Arbeiten mit Papier, vor allem ihre Landkarten, bei denen sie so viel wegschneidet, dass am Ende nur noch das feine Gitterwerk der Strassen, Autobahnen und Wasserwege übrigbleibt. Ein Interesse am Formalen, das sich auch in ihren Comics niederschlägt, wenn sie ihre Geschichten in Form einer Ziehharmonika oder zum Abrollen gestaltet, oder auch als Panorama-Zeichnungen, die vom Leser ringförmig zu «skulpturalen Landschaften» aufgereiht werden sollen.
Franklins neuestes Buch hingegen, «Making Tide» (2013), beweist ihr Interesse an traditionelleren Formen des Comics. Die längste Geschichte des Buches handelt von einer Reise nach Vietnam, auf der die Protagonistin – offenbar die Autorin selber – sich in einem Zwiespalt befindet, ob sie ihre Eindrücke fotografieren oder sich einfach dem Erleben hingeben soll. Eroyn gebraucht dafür eine starke Mischung aus Cartoon-Figuren und gemalten Hintergründen, um Spannung zu erzeugen. Die Geschichte endet in einer Tragödie, welche die Sorgen der Protagonistin unbedeutend erscheinen lassen.
In ihrem vorhergehenden Buch «Another Glorious Day at the Nothing Factory» (2009) erzählt Eroyn Franklin mittels gekonnter Papierschnitt-Bilder (die an Kara Walker, Stéphane Blanquet oder Anna Sommer erinnern) vom schmerzlichen Zerfall einer unklugen Ehe. Die autobiographische Geschichte vermeidet jegliche unreife Oberflächlichkeit, wie sie bei allzu vielen jungen Comic-Autorinnen und - Autoren aufscheint. Franklin brilliert
mit poetischer Prosa, provokativen Wortspielen, die an Nabokov erinnern, und erforscht Aspekte von Wahr-
nehmung, Perspektive und Empathie in menschlichen Beziehungen. Es geht um den Wert und die Vergäng-lichkeit von Kommunikation; um die Erlösung, die in Zeiten von Trauer und Verlust in der Einsamkeit liegen kann. Bevor ich diesen Text schrieb, habe ich dieses Buch zweimal gelesen und werde es, da es mich immer wieder zu fesseln vermag, bald wieder lesen.
Alle von Franklins Büchern sind im Eigenverlag erschienen, dieses Meisterstück aber sollte endlich dazu führen, dass sie von einem Verlag entdeckt und einem grösse-ren Publikum bekannt wird.
Mark David Nevins
Franklins Werke sind in Europa nur über ihre Website erhältlich:
www.eroynfranklin.com
Eroyn Franklin: «Making Tide and Other Stories».
Eigenverlag, 22 S., Siebdruck-Umschlag, s/w, $ 4.00
Eroyn Franklin: «Another Glorious Day at the Nothing Factory».
Eigenverlag, 216 S., Siebdruck-Umschlag und von Hand geschnittener Schutzumschlag,
s/w, limitierte Auflage von 1000 Exemplaren, $ 25.00
J. Jensen, J. Case: Green River Killer und P. Meter, D. von Bassewitz: Vasmers Bruder
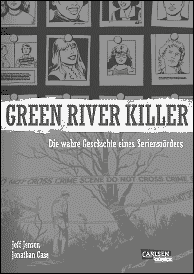
Killing Me Softly
Gleich zwei aktuelle Veröffentlichungen bei Carlsen befassen sich mit den Taten wahrhafter Serienkiller. In ihrer erzählerischen und zeichnerischen Umsetzung jedoch könnten die beiden Comics unterschiedlicher nicht sein. Jeff Jensen erzählt mit «Green River Killer» in erster Linie die Geschichte seines Vaters, der als Detektiv den Serienkiller über 19 Jahre verfolgte, ehe Gary Ridgway endlich anhand einer DNS-Analyse überführt werden konnte. Gary Ridgway alias Green River Killer tötete in den USA von 1982 bis zu seiner Festnahme 2001 rund 50 Frauen in Seattle und Umgebung. In realistischen Schwarzweiss-Zeichnungen illustriert Jonathan Case die nüchtern erzählte Geschichte von Jensen, die an einen Untersuchungsbericht erinnert. Doch unter all der Nüchternheit schimmert Jensens verzweifelter Versuch durch, die langjährige Obsession seines Vaters zu verstehen, unter der die gesamte Familie gelitten hat, er selbst eingenommen.
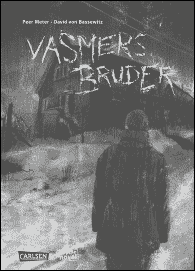
«Vasmers Bruder» von Peer Meter und David von Bassewitz befasst sich ebenfalls mit dem Thema Serienmord, aber auf einer völlig anderen Ebene. Meter, der bereits Texte und Szenarien für die Serienmörder-Comics «Haarmann» (Storyboard und Zeichnungen: Isabel Kreitz) und «Gift» (Storyboard und Zeichnungen: Barbara Yelin) geschrieben hat, wählte diesmal einen neuen, äusserst interessanten Ansatz. Dieses Mal hat der Autor keine möglichst dokumentarische Erzählung über den Fall des Serienmörders und Kannibalen Karl Denke geschaffen, der zwischen 1903 und 1924 in Schlesien mindestens 30 Menschen tötete. Das wäre vermutlich auch nicht möglich gewesen, denn bevor Denke damals verhört werden konnte, hatte er sich erhängt, so dass man nie etwas über seine Motive erfuhr. Auf der Grundlage dieser Begebenheit erzählt Meter stattdessen die Geschichte eines Mannes, der zur heutigen Zeit in das polnische Ziebice reist, um über Denke zu forschen. Der Protagonist wird mit der Geschichte einer Stadt konfrontiert, die geprägt ist von deutscher Vergangenheit und polnischer Gegenwart sowie ihrem dunkelsten Kapitel. Von Bassewitz‘ grauschwarze und unscharfe Bilder unterstreichen kongenial das düstere und beklemmende Szenario, das den Protagonisten wie in einem Albtraum immer tiefer in den Abgrund blicken lässt, dem er schliesslich nicht mehr entrinnen kann. «Vasmers Bruder» ist ein äusserst beklemmender Comic und darüber hinaus ein psychologisches Stück, das den Leser völlig in seinen Bann zieht.
Matthias Schneider
Jeff Jensen, Jonathan Case: «Green River Killer».
Carlsen Verlag, 240 S., Hardcover, s/w,
Euro 18.90 / sFr. 28.90
Peer Meter und David von Bassewitz: «Vasmers Bruder».
Carlsen Verlag, 176 S., Hardcover, s/w,
Euro 18.40 / sFr. 25.90
Zak Sally: Sammy the Mouse: Book 2
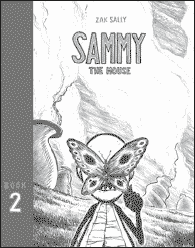
Not So Funny Animals
Die Serie «Sammy the Mouse» von Zak Sally hat bereits mehrere Erscheinungsformen durchlaufen: Die ersten drei Bände erschienen ab 2007 bei Fantagraphics; Sally selbst veröffentlichte diese später – zusammengefasst
als «Book 1» – in seinem Kleinstverlag La Mano 21, und «Book 2», das die Teile IV und V enthält, erschien schliesslich bei Uncivilized Books. Ebenso wie «Book 1» ist auch «Book2» nur etwa halb so gross wie die Fantagraphics-Bände, die Bilder sind also stark verkleinert. Ausserdem ist die Druckqualität geringer und das Papier weniger hochwertig, so dass die typischen Buntstiftstriche und Schraffierungen weniger prägnant und die Farben weniger kräftig daherkommen.
Der erste Eindruck ist also etwas enttäuschend. Das legt sich aber zum Glück, sobald man wieder in die Geschichte und die absurde Welt von Sammy eintaucht. Die oft an klassische Comic-Figuren angelehnten Charaktere sind alle wieder mit dabei: neben dem wie ein heruntergekommener Mickey Mouse wirkenden Sammy selbst z. B. Feekes, eine Ente mit Abraham-Lincoln-Bart, Zylinder und ständigem Schnapsdurst, Carl Urbanski, der Charlie Browns Pullover trägt, der gar nicht kuschelige Hase Pat und natürlich Sammys bester Freund Puppy Boy. Und dann gibt es auch noch zwei Special-Guest-Auftritte, die hier aber nicht verraten werden sollen. In Verbindung mit den meist düsteren und selt-
samen Aussendarstellungen und Räumen, dem herben Umgangston der Figuren, ihrem hohen Alkoholkonsum und dem schwarzen Humor entsteht so etwas wie eine Parodie eines an George Herriman erinnernden Funny-Animals-Comics, die wie eine dunkle Gegenwelt zu Entenhausen wirkt.
Ebenso werden die bekannten Handlungsstränge fortgeführt, wobei im Mittelpunkt wieder Puppy Boys mysteriöses Projekt steht. Aufgelöst wird aber nichts, stattdessen entstehen immer weitere Fragen. Und was es mit dem gruseligen kleinen Männchen, dem gehörnten Monster oder der Stimme «von oben» (Ist es Gott? Oder vielleicht der Autor, der seinen Figuren Anweisungen gibt?) auf sich hat, erfährt man ebenfalls nicht. Immerhin erhält man ganz am Ende einen Blick auf Puppy Boys Projekt. Aber auch diese doppelseitige Spread-Page erklärt im Grunde gar nichts, sondern
lässt alles offen.
Zwei weitere Bücher werden noch folgen, und Sally verspricht, dass sich am Ende alles auflösen wird. Fast schade, dass man damit weiss, dass der Geschichte ein Ende gesetzt ist. Denn eigentlich möchte man diesen skurrilen Charakteren weiter durch ihre merkwürdige Welt folgen, die immer wieder voller Überraschungen steckt.
Jan Westenfelder
Zak Sally: «Sammy the Mouse: Book 2». Uncivilized Books
98 S., Softcover, 2-farbig, $ 15.00
Ed Piskor: Hip-Hop Family Tree
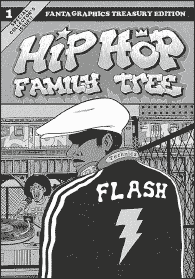
Wild Style
Als in den 80er-Jahren spät abends der Film «Wild Style» beim kleinen Fernsehspiel im öffentlich rechtlichen deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde, sass der Autor dieser Rezension im Schlafanzug und mit grossen Augen vor dem Bildschirm. Eine neue Welt tat sich ihm auf, aus Breakdance, Graffitis und einer bis dahin nie gehörten Musik, dem Rap bzw. Hip-Hop. Da er noch nicht einmal in der Pubertät steckte, also keine Schallplatten mit Musik besass, mussten am nächsten Tag seine Märchenplatten für erste Scratch-Versuche herhalten. «Wild Style» wurde der erfolgreichste Film über die damals aufkommende amerikanische Jugendkultur – die Hip-Hop-Szene, die auf der Strasse entstand und zelebriert wurde.
Ed Piskor ist 1982 geboren, zur ersten Hochzeit des Hip-Hop. Nach der Lektüre von Piskors grandiosem Comic über den Stammbaum des Hip-Hop, seinem «Hip-Hop Family Tree», könnte man sich die Frage stellen, ob er den Hip-Hop mit der Muttermilch aufgesogen hat, so detailreich, spannend und unterhaltsam erzählt er von den Anfängen dieser aufkeimenden Jugend- und Popkultur, zudem reichert er seine Darstellungen mit zahlreichen Insider-Anekdoten an. Darin tauchen Afrika Bambaataa und Grandmaster Flash als Protagonisten auf, aber vor allem die weniger bekannten Wegbereiter des Hip-Hops erhalten von Piskor eine längst überfällige Ehrerbietung, wie unter anderem DJ Kool Herc, The Cold Crush Brothers und The Treacherous Three. Darüber hinaus hat sich Piskor als Schüler von Harvey Pekar und Jay Lynch einen sehr ansprechenden Zeichen- und Erzählstil angeeignet, der vom amerikanischen Underground- sowie Superhelden-Comic der 70er- und 80er-Jahre geprägt ist. Um die Reise in die Vergangenheit zu unterstreichen, sind die Bilder grob gerastert und das Papier gelblich verblichen eingefärbt.
«Hip-Hop Family Tree» ist ein absolutes Muss für jeden, der sich nur im entferntesten für Jugend- oder Popkultur interessiert, und für Hip-Hop-Fans sowieso. Ed Piskor glorifiziert den Hip-Hop nicht, er thematisiert auch die früh einhergehende Kommerzialisierung, die der anfänglich so kreativen Jugendkultur ihre Innovation raubte. Piskors Comic ist eine Verbeugung vor den Wurzeln des Hip-Hops und seiner treibenden kreativen Kräfte, die diese Bewegung zu einer der wichtigsten afroamerikanischen Jugendkulturen werden liessen. In Deutschland wird Ed Piskor dieses Jahr als Gast am Comic-Salon Erlangen zu sehen sein.
Matthias Schneider
Ed Piskor: «Hip-Hop Family Tree». Metrolit Verlag
120 S., Hardcover, farbig, Euro 22.90 / sFr. 33.90
Kurz und Gut
von Christian Meyer
Loic Dauvillier & Glen Chabron: «Das Attentat». Carlsen
160 S., Hardcover, farbig, Euro 18.90 / sFr. 27.50
Peggy Adams «Gröcha» erinnert zunächst an eine klassische Apokalypse: Eine Seuche geht um, die Staatsmacht interniert die Kranken und kontrolliert die Strassen, um die Krankheit einzudämmen. Im Zentrum steht eine Kleinfamilie: Das Kind ist bereits tot, die Frau infiziert, und der Mann flieht in eine Berghütte. Dort holt ihn sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart ein. Die bedrückende Schwarzweiss-Geschichte endet mit verstörenden Bildern im surrealen Wahn.
Peggy Adams: «Gröcha». Avant-Verlag
104 S., Softcover, s/w, Euro 19.95 / sFr. 29.90
Die Story ist eher eine Kurzgeschichte: Jan flüchtet vor Liebeskummer in eine Wanderung durch das Hinterland Australiens. In der Einsamkeit trifft er auf die Französin Morgane und sein Selbstfindungstrip gerät aus der Bahn. Jan Bauers Debüt «Der salzige Fluss» will trotz der 200 Seiten kein Epos, sondern eine Momentaufnahme sein. Bauer erzählt sehr detailliert von den Erlebnissen auf der Wanderung und sehr persönlich von seinem unsortierten Gefühlsleben. Wie er seine Erlebnisse genau und humorvoll schildert und sein Gefühlsleben in metaphorische Bilder verpackt, zeugt durchaus von erzählerischer Qualität.
Jan Bauer: «Der salzige Fluss». Avant Verlag
240 S., Softcover, s/w, Euro 19.95 / sFr. 29.90
«Cromwell Stone» von Andreas erscheint erstmals komplett auf Deutsch. Zuerst fallen die extrem detailreichen, stichartigen Zeichnungen des in Frankreich lebenden deutschen Zeichners auf: Jedes Bild der Trilogie könnte einzeln im Museum hängen. Doch auch die an Autoren wie Poe, Lovecraft oder Hoffmann angelehnte Story zwischen Fantasy, Horror und Metaphysik ist alles andere als bescheiden: Es geht um nichts weniger als einen göttlichen Schöpfer, der auf der Erde feststeckt und mit aller Kraft zurück ins Universum will. Ein überbordendes, faszinierendes Werk.
Andreas: «Cromwell Stone». Schreiber & Leser
144 S., Hardcover, s/w, Euro 24.80 / sFr. 37.90
Jens Harder hat vor ein paar Jahren den wahnwitzigen Entschluss gefasst, die Weltgeschichte als Comic umzusetzen. Im ersten Band «Alpha … directions» hatte er auf 360 Seiten von 14 Milliarden Jahren erzählt. Der zweite Teil «Beta … civilisations» umfasst nur gut 4 Millionen Jahre und endet ohne religiösen Hintergedanken bei der Geburt Christi. Hier springt er immer wieder überraschend durch die Zeit, um Innovationen und Entwicklungen zu veranschaulichen: Vom Auge zur Kamera, vom ersten aufrechten Gang zu den Beatles auf der Abbey Road. Beta 2 wird bis in die Gegenwart reichen, Gamma wird einen Blick in die Zukunft wagen.
Jens Harder: «Beta … civilisations». Carlsen,
268 S. ,Hardcover, zweifarbig, Euro 49.90 / sFr. 65.
«Der fünfte Beatle» ist eine Comic-Biographie über Brian Epstein, den Manager der Beatles. In dieser visuell durch Andrew C. Robinson (unter Mitwirkung von Kyle Baker) äusserst aufwändig und vielseitig umgesetzten Annäherung an das Leben des kreativen Geschäftsmannes betont der Autor Vivek J. Tiwary die tragischen Seiten von Epsteins kurzem Leben – seine Einsamkeit, seine Tablettensucht und seine verheimlichte Homosexualität. Im Hintergrund glitzert der rasende Aufstieg der Fab Four.
Andrew C. Robinson & Vivek J. Tiwary: «Der fünfte Beatle». Panini,
172 S., Hardcover, farbig, Euro 24.99 / sFr. 36.90
Agnieszka will Kunst studieren, erhält aber nur in Polen einen Studienplatz. Dort versinkt sie in Orientierungslosigkeit und Selbstmitleid, während ihr ihre Mutter mit ihren Ansprüchen im Nacken sitzt. Die war einst aus Polen emigriert und arbeitet nun erfolgreich in Deutschland. Paulina Stulin skizziert in «Mindestens eine Sekunde» mit schnellem Strich eine junge Frau an einem dramatischen Wendepunkt ihres Lebens, an dem es gilt, Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen. Nach «Huck Finn» erzählt Olivia Vieweg in «Antoinette kehrt zurück» ebenfalls von einer jungen Frau. Antoinette war in ihrer Schule Mobbing-Opfer. Als sie ins Ausland geht, feiert sie Erfolge als Creative Director. Eines Tages zieht es sie zurück in ihre Heimat – zurück zu den Traumata ihrer Jugend. Vieweg ist Manga-geschult, hat sich aber inzwischen mit ganz eigenem Stil emanzipiert. Die emotionalen Abgründe fängt sie in diesem Album eindrucksvoll ein.
Kleine Bösartigkeiten verpackt auch Bastien Vivès in seiner Kurzgeschichtensammlung «Die Liebe». Hier geht es eher um die Missverständnisse, die Machtkämpfe und die Enttäuschungen. Gewidmet ist der Band allen Frauen, die ihn kaputt gemacht haben. Oje …
Paulina Stulin: «Mindestens eine Sekunde». Jaja Verlag
116 S., Softcover, s/w, Euro 15 / sFr. 21.90
Olivia Vieweg: «Antoinette kehrt zurück». Egmont Graphic Novel,
96 S., Softcover, zweifarbig, Euro 14.99 / sFr. 22.90
Bastien Vivès: «Die Liebe». Reprodukt,
S., Softcover, s/w, Euro 12 / sFr. 18.90
Das auf vier Teilen à 200 Seiten angelegte «Blast» von Manu Larcenet ist eine einzige lange Verhörszene eines Mordverdächtigen. Was genau Polza getan hat, wird lange nicht klar. Stattdessen wird in Rückblenden dessen nihilistische Befreiung von jeglicher zivilisatorischen Last ausgebreitet. Im dritten Band kommt Polza erstmals auf die eigene Tat zu sprechen. Ein bildgewaltiges und abgründiges Meisterwerk.
Manu Larcenet: «Blast – Augen zu und durch». Reprodukt,
208 S., Hardcover, farbig & s/w, Euro 29 / sFr. 40.90
Vor ungefähr zehn Jahren hat «Didi & Stulle»-Erfinder Fil für die Zeitung Jungle World den Strip «Mädchenworld» erfunden. Leider hielt die Zusammenarbeit nicht a ma fliegt vom Ponyhof, flüchtet sich in eine fabelhafte Fantasiewelt und erlebt aberwitzige Abenteuer. Nicht nur für Fil-Fans ein Muss. Seit 2003 veröffentlicht 18 Metzger aus Köln seinen Strip «Totes Meer» in der Zeitschrift Jungle World. Das Szenario ist an Matrosen auf See geknüpft, inhaltlich hat aber so gut wie alles darin Platz. Neben dem grossartig abgründigen Humor sind daher auch die vielen allegorischen Verweise ein ständiger Quell der Freude. Jetzt erscheint der erste, kommentierte Sammelband im amtlichen Hardcover-Format.
Fil: «Mädchenworld». Zitty Verlag,
132 S., Hardcover, farbig, Euro 14.90 / sFr. 22.90
18 Metzger: «Totes Meer». Ventil Verlag,
140 S., Hardcover, farbig, Euro 19.90 / sFr. 29.90
Der intensiv recherchierte Band «Unsichtbare Hände» des Finnen Ville Tietäväinen erzählt vom Schicksal des Tunesiers Rashid, der mit Hilfe von Schleppern nach Spanien kommt und dort zwischen Staatsmacht und illiegaler Plantagenarbeit die dunkle Seite der westli-chen Welt kennenlernt. Die aufwändig illustrierte Geschichte ist fiktiv, beschreibt aber ganz allgemein die Situation der Asyl suchenden Flüchtlinge aus Afrika. In einem langen ersten Teil lernt der Leser auch die Hintergründe für die gefährliche Reise nach Spanien
kennen.
Ville Tietäväinen: «Unsichtbare Hände». Avant Verlag,
216 S., Hardcover, farbig, Euro 34.95 / sFr. 47.90
Mit «Schattenspringer» bringt Daniela Schreiter dem Leser ihre Erlebniswelt als Asperger-Autistin näher. Sie erzählt von ihrer Kindheit und Jugend, dem Gefühl der permanenten Reizüberflutung und der Empfindung, auf dem falschen Planeten gelandet zu sein. Im Funny-Stil und mit viel Humor nähert sie sich dem Thema. Das ist erkenntnisreich und berührend zugleich. Das Lesevergnügen wird alleine dadurch geschmälert, dass der Erzählfluss gehemmt bleibt, weil Schreiter stets als Off-Erzählerin präsent bleibt, statt die Situationen
von innen zu erzählen.
Daniela Schreiter: «Schattenspringer». Panini,
160 S., Hardcover, Euro 19.99 / sFr. 29.90
