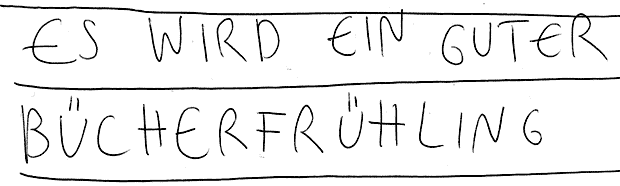
von Wolfgang Bortlik
Es ist wieder soweit. In der Welt des geschriebenen Wortes tanzt der Bär. Buch um Buch kommt heraus, Verlag um Verlag und Autor um Autor hofft. Haut die Werbung (»Das grösste Buch seit der Bibel«) hin? Habe ich alle Kommas strategisch richtig gesetzt? Hat der Grosskritiker bemerkt, dass wir ihm vierzig Rosen geschickt haben? Never mind the bollocks, jubelt der Rezensent. Hier sind die besten Bücher des Frühjahrs 2007!
Dreissig Dosen Hürlimann Lager hat ein gewisser Hundhammer in seinem geräumigen Kühlschrank aufgereiht, denn folgendes hat sich dieser Hundhammer vorgenommen: Wenn er bei der allerletzten Dose der fünf Sixpacks angelangt ist, dann hat er entweder aufgehört zu saufen oder er hat seine Frau zurückerobert. Am liebsten natürlich beides! Aber das merkt Hundhammer erst im Laufe der Dosen 19 und 20.
Vorher berichtet dieser flotte Roman aus dem beschädigten Leben von Henry Hundhammer, der als unehelicher Sohn eines Admirals der Schweizer Gebirgsmarine auf einer Windjammer zur Welt kommt und fürderhin das nasse Element über alles liebt – vor allem, wenn man es mit Alkohol versetzt in sich hinein schütten kann. Hundhammer geht aber auch durch die schwere Schule des Existenzerwerbs, er verkauft selbstschliessende Garagentore, recyclierbare Christbäume und Dampfradios. Bis er Mathilde kennen lernt, die Frau seiner Träume. Hundhammer heiratet die designierte Erbin eines Zuger Derivate-Händlers und richtet sich auf ein glückliches Leben jenseits allen Erwerbsstrebens ein. Doch Mathilde entfremdet sich ihm plötzlich, und ab Dose 25 versucht Hundhammer alles, um diese Distanz zu überwinden. Er nimmt den Zug, das Fahrrad, skatet – alles vergeblich. Als er Dose 30 in der zitternden Hand hält ... Aber das überraschende Ende des neuen Romans von Kuno Klötzer soll hier nicht verraten werden. Der grosse junggebliebene Mann der deutschsprachigen Tragikomödie schreckt wie immer auch diesmal nicht vor narrativen Selbstschüssen zurück. Seine Prosa ist so hochprozentig wie immer und bohrt gnadenlos in die Tiefen des menschlichen Bergwerks. Man hätte sich einzig gewünscht, dass er einem etwas temperamentvollerem Bier als Hürlimann die Hauptrolle in seinem Roman gegeben hätte.
Kuno Klötzer: Dreissig Dosen. Roman, Amavita Verlag, 240 Seiten, Euro 20.— / sFr. 36.—
Die Vernichtung des Schönen im Konkreten ist ein< Vergehen, das man dem Lyriker nur ungern nachsieht. Von hinten schauen eben alle Lyriker wie Dichter aus. Wenn aber einer es wagt, Zeilen zu schreiben wie »Ich hau dem Schönen/konkret eins in die Schnauze«, dann weiss er, was er sagt. Das schmale Werk von Gregg Berhalter wird durch sein neuestes Lyrikbändchen nicht wesentlich dicker. Aber wir sind reicher, ja, unendlich reich und weise nach der Lektüre von lyrischen Preziosen wie »Am Ende/bin ich/eh wieder/der Dumme«.
Nun wissen wir, dass wir sind! Nun wissen wir, was wir sind! Ein dunkles Fest des Ichs, ein funkelndes Massaker des Wirs sind Berhalters Zeilen schon immer gewesen. »Wer nix wird, wird Wirt!«, ist an anderer Stelle zu lesen.
Berhalter greift oft zu Daktylen und Anapästen, dynamischen, mehrhebigen Takt-Arten, die seiner inneren Unruhe entgegenkommen. Das poetische Sprechen ist seine natürliche Äusserungsart, auch wenn es meist erfreulich lakonisch ist: »Halt deine Mund/und/zahl noch ein Rund«.
Gregg Berhalter: Konkret schön ist prima! Gedichte & Lyrik, Rowohlt Bern, 27 Seiten, Euro 20.— / sFr. 37.—
Dass in der deutschsprachigen Literatur von heute nur noch der Krimi politische Anliegen transportiert, ist eine leidige Erkenntnis, die offensichtlich auch Basil Vadder, der Papst des Schweizer Familienromans, gewonnen hat. Kaum sonst hätte er sein überwältigendes sprachliches Feingefühl so auf Mord und Totschlag gelegt wie in diesem seinem neuesten Werk.
Bei der jährlichen Rede des Rechtspopulisten Ballaman an seine treuen Parteigänger kommt eine junge Frau zu Schanden. Gerät sie unter die gnadenlos ratternden Räder der Politik? Oder verguckt sie sich in den charismatischen Ballaman, wer weiss? Vadder lässt dies bewusst offen, doch uns allen ist sofort klar, dass hier ein Verbrechen vorliegt. Ballaman aber wird von keinerlei Selbstzweifel gepackt. Jedenfalls zeichnet ihn Vadder so: als Mensch, der nicht Mensch werden kann, weil er sich selbst im Weg steht. Wie sonst könnte man das folgende Statement Ballamans anlässlich einer weiteren Rede interpretieren: »Wenn ein Zürcher namens Berner in Basel Fussball spielt, dann kann man nicht mehr von einer heilen Heimat sprechen. »
Unterdessen verwüsten jugendliche Ökofaschisten die Gemüseabteilungen der Supermärkte. Exotisches explodiert, nur arische Gewächse wie Räben, Kohl und Kabis bleiben unbehelligt. Ganz nebenbei erfährt die atemlose Leserschaft, dass Ballaman einst in jungen Jahren ein Buch mit dem Titel »Die erfreuliche Sauerkrautküche« geschrieben hat! Nun taucht auch die junge Frau trotz schwerer politischer Verstörungen wieder auf und entpuppt sich als Agentin der Vereinigung Schweizerischer Biobäuerinnen. Sie hat den heiklen Auftrag, der roten Beete, gemeinhin auch Rande genannt, zu einer besseren Performance auf dem internationalen Finanzmarkt zu verhelfen.
Unterdessen geht Ballaman unbeirrt seinen Weg, um Diktator der Schweiz zu werden. Damit er ans Ziel kommt, muss Ballaman – gemäss Vadders Roman – genau 79 Konkurrenten aus dem Weg räumen. Ballaman muss also 79 Morde begehen oder begehen lassen. Die Vorbereitungen zu diesen Taten sind in diesem Roman äusserst detailliert beschrieben. Wem käme schon in den Sinn, jemand mit einem halben Pfund frisch vergorenem Sauerkraut umbringen zu wollen? Aber gerade diese empirische Detailtreue, diese opulente Darstellung der Vorbereitungen zu einem Verbrechen mögen die stärksten Stellen des erfreulich psychedelischen Romans sein.
Basil Vadder: Die erfreuliche Sauerkrautküche. Roman, Kriminalverlag St. Adelheim, 894 Seiten, Euro 20.— / sFr. 38.—
Darf die das? Eine Frau, die darüber schreibt, wie sie die Jungs von Led Zeppelin auf den Drogenstrich schickt und weshalb sie Jimi Hendrix von der Bettkante gestossen hat.
Sir U2-Bono hat sie als die Inge Aichinger des Rock’n’Roll bezeichnet, während Sir Bob Geldof darauf beharrt, sie sei die Elfriede Jelinek des Rock’n’Roll. Tatsache bleibt, dass sie all das Gesocks von Sir Paul bis Sir David, von Iggy Stooge bis Iggy Pop genauestens gekannt hat. Was man bis anhin nicht wusste – und da wirkt diese Autobiografie selbstverständlich segensreich mit ihren intimen Informationen – was man also bis anhin nicht wusste – und da gibt uns diese Autobiografie endlich einmal ebenso präzise wie erschöpfend Auskunft – was man eben genau nicht wusste, war, dass sie, die vermeintliche Muse, höchstselbst mindestens die Hälfte aller guten Songtexte der späten Sechzigerjahre und fast alle guten Rocktexte der Siebzigerjahre geschrieben hat: Perlen wie »I walked with a Zombie«, »Big Ass in the Sky« oder »Lady in Black«. Sogar Bob Dylan soll nur deshalb religiös geworden sein, weil er das Gefühl hatte, literarisch nicht an sie heranzukommen. Doch vor > dem Text kommt immer das Leben. Das Leben auf der wilden Seite! Und immer Drogen, Drogen, Drogen: Liköre, Klosterfrau Melissengeist und bald auch Schärferes!
Zu ihren Rockschwestern allerdings hat sie lebenslang eine grosse Distanz bewahrt: Janis Joplin war für sie eine wandelnde Leberzirrhose, Mama Cass ein wandelndes Schinkensandwich und Frieda Mercury ein wandelnder Porzellanpisspott. Wen sie hingegen echt mochte, das war Ludwig Van, der olle Beethoven. Weil der Kerl so taub war und so süss, begründet sie ihre seltsame Vorliebe. Von Altersmilde ist in diesem radikalen Buch jedenfalls keine Rede, und deswegen ist es mit seiner Aussage auch für die arschlose Jugend von heute geeignet: Das habt ihr glücklicherweise alles verpasst!
Marlene Hugelshofer: Ich und Ludwig. Erinnerungen an wilde Zeiten. Autobiografie, Verlag Hofmann & LaRoche, 340 Seiten, mit einem von Albert Hofmann signiertem Trip,
Euro 20.— / sFr. 39.—
Sachbücher sind eine Pest. Sie sind sperrig, kommen einem beim Geschlechtsverkehr in den Weg und kosten viel Geld, wobei ihr Nutzen zweifelhaft bleibt. Deswegen sei hier noch ganz kurz auf das Sachbuch vom Sachbuch hingewiesen, welches einem schon mit dem ersten Satz ganz unmittelbar mit einer Erkenntnis ins Gesicht springt: »Sachbücher sind sperrig, kommen einem beim Geschlechtsverkehr in den Weg und kosten viel Geld, wobei ihr Nutzen zweifelhaft bleibt.»
So kurz und prägnant kann man also Sachbücher geisseln! Ansonsten gibt’s doch immerhin Überraschendes in diesem Band: Hier wird genau erklärt, warum es etwa kein Sachbuch geben kann darüber, wie man am effektivsten im juckenden Ohre bohrt. Oder warum es kein Sachbuch über den Missbrauch von Büroklammern und Brillenbügeln als Ohrenbohrer gibt.
Diese Erkenntnis hält den Sachbuchautoren jedoch nicht davon ab, der durchlichteten Düsternis
seiner Prognosen am Ende eine Art ruhige Zufriedenheit abzugewinnen: Das Sachbuch wird dennoch nicht sterben!
Hilmar von Hinüber: Res Publica. Das Sachbuch vom Sachbuch. Sachbuch, Edition Sachbuch im Sachbuchverlag, 200 Seiten, Euro 20.— / sFr. 39.90<